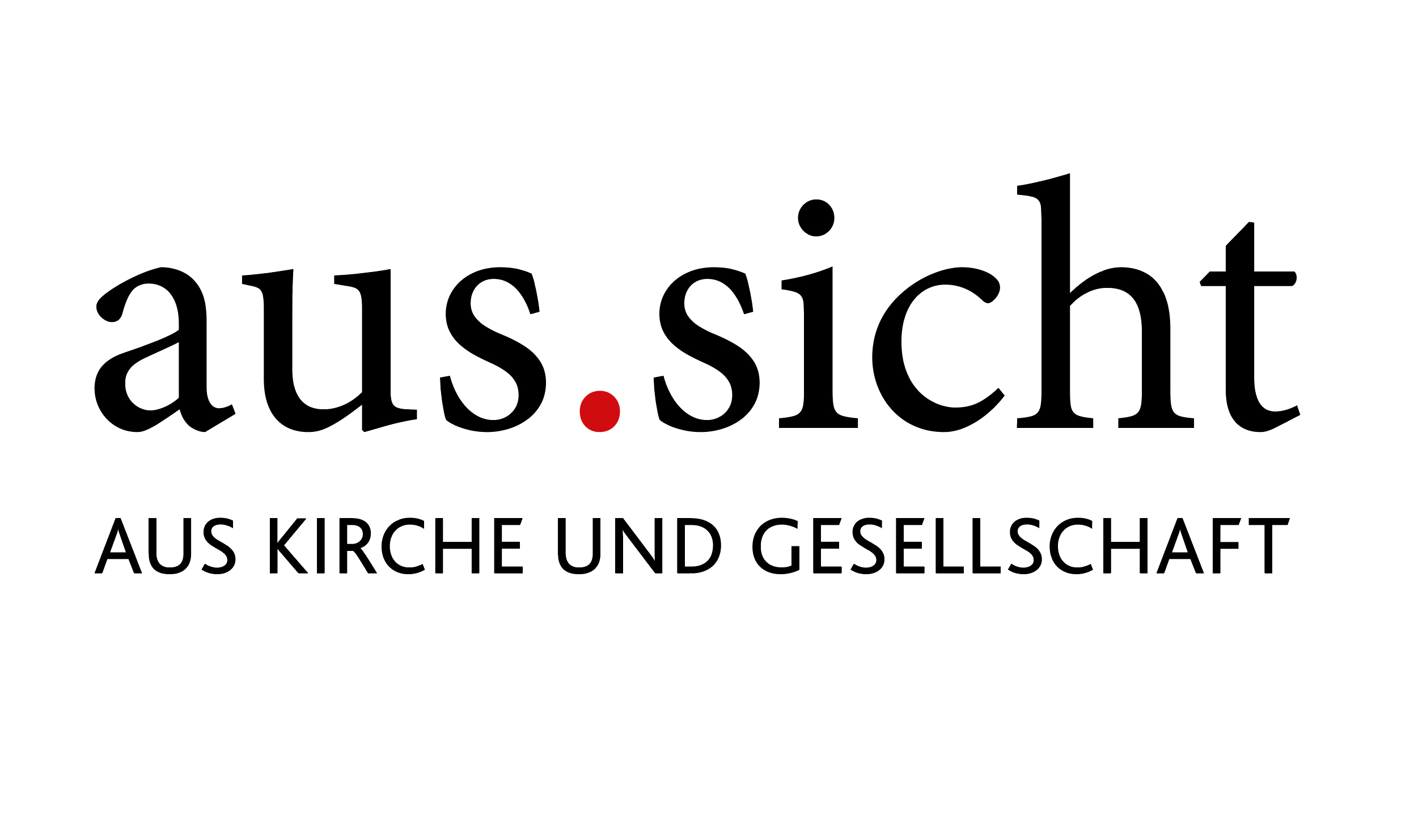Wie der Sozialdienst katholischer Frauen Jugendlichen in Not hilft
Die letzte Anlaufstelle

Fotos: kna/Annika Schmitz
Freundlich aber steril: Eines der Zimmer im Reichenspergerhaus.
Beherzt fischt Peter Brüggemann aus dem klatschnassen Handtuchberg ein Paar schwarze Socken und eine Unterhose heraus. Er legt sie in die Ecke des funktional eingerichteten Badezimmers. Die Handtücher wirft er schwungvoll in einen Wäschekorb und tritt in die Dusche. Dort stapeln sich leere Seifenflaschen und benutzte Einmalrasierer, die nun in den Müll wandern. Besonders auf die Rasierer hat er einen Blick, sagt der Sozialarbeiter. Manche Mädchen würden sich damit selbst verletzen.
Der Satz lässt erahnen, wie der Alltag im Reichenspergerhaus aussieht. An diesem Tag ist es ruhig in der einzigen Inobhutnahme für Mädchen zwischen 14 und 17 Jahren in Köln. Nichts erinnert daran, dass nur zwei Stunden zuvor Farina wütend gegen ein vor der Tür parkendes Auto getreten hat. Sie stand am frühen Morgen wieder vorm Haus und wollte ins Bett. Doch Farina war abgängig – sie ist die ganze Nacht über nicht zurückgekehrt. Ihren Schlafplatz hat sie damit eigentlich verwirkt. Denn wer sich so sehr verspätet, dass er nach 6 Uhr morgens wieder am Haus ist, bekommt einen neuen Schlafplatz erst ab 15 Uhr – solange der körperliche und psychische Zustand das zulassen.
Es ist eine der wenigen Regeln, die es hier gibt: keine Drogen und Waffen im Haus. Keine Gewalt. Keine rassistischen Äußerungen. Und das Einhalten der Ausgehzeiten. „Wir haben keinen weitreichenden Erziehungsauftrag und auch keine Handhabe, wenn sich jemand nicht an die Regeln hält“, erklärt die Pädagogische Leiterin Maren Rasch.

Die vierstöckige Einrichtung des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) ist die letzte Anlaufstelle für Jugendliche in einer akuten Notsituation. Sie ist das Ende des Sozialsystems. Hier schläft, wer nicht nach Hause kann. Oder wer minderjährig und allein nach Deutschland geflohen ist. 15 Mädchen haben die vergangene Nacht im Haus verbracht. Darunter eine schon bekannte 14-Jährige mit Drogenproblemen. Mehrere Geflüchtete, mit denen die Verständigung schwierig ist. Und Lisa, die sich vermutlich prostituiert und nachts oft unterwegs ist.
Welche Dramen sich in der Einrichtung in dem gehobenen Kölner Stadtteil Lindenthal abspielen, ist von außen nicht sichtbar. Direkt auf der anderen Straßenseite steht eine Privatschule. Die kleine Nebenstraße trennt beide Welten, die sich nie kreuzen. Nur wenn es zu Ausschreitungen kommt, fallen die Mädchen auf.
„Sie sind unsichtbar“, sagt Rasch. Dabei sind sie doch überall. Die Jugendämter in Deutschland haben im vergangenen Jahr mehr als 66 000 Minderjährige zu deren Schutz vorübergehend in Obhut genommen – knapp 19 000 mehr als im Vorjahr. In 43 Prozent der Fälle geschah dies wegen einer unbegleiteten Einreise. Danach folgen Überforderung der Eltern, Anzeichen für Vernachlässigungen und körperliche Misshandlungen.
Die Inobhutnahme soll normalerweise auf drei Wochen beschränkt sein. Ein kurzer Moment des Durchatmens, in dem nach Perspektiven gesucht wird: etwa nach Wohngruppen oder Pflegefamilien, nach familiären Lösungen – zum Beispiel der Rückkehr zu den Sorgeberechtigten oder einer Unterbringung im Verselbstständigungsbereich.
Die Jugendhilfe fliegt unter dem Radar der Öffentlichkeit, sagen die Mitarbeitenden. Es fehlt an Personal, Geld und längerfristigen Wohnmöglichkeiten. Das Reichenspergerhaus wird deswegen für manches Mädchen über Monate hinweg zur Dauerschlafstelle. „Wir können sie nicht einfach rauswerfen – und wollen das auch nicht“, sagt Rasch. „Nach uns kommt ja niemand mehr.“ Wenn die 18 Einzelzimmer belegt sind, werden Matratzen in die beiden Wohnzimmer gelegt.
Die Arbeitstage der rund 30 Mitarbeitenden sind vor allem mit akuter Krisenintervention gefüllt. Für alles andere ist kaum Zeit. Jede Situation muss individuell gelöst werden, selbst an ruhigen Tagen wie diesem.
„Wir können streiten, ob das pädagogisch sinnvoll ist“
Farina hat sich am Morgen einfach vor die Haustür gelegt – und durfte schließlich früher aufs Zimmer. „Wir können jetzt darüber streiten, ob das pädagogisch sinnvoll ist“, sagt eine Sozialarbeiterin. „Aber es bringt doch auch nichts, wenn sie den ganzen Tag vor der Tür schläft.“ Sandra und Maria haben die eigentlich strikte Mittagessenszeit verschlafen. Peter Brüggemann drückt ein Auge zu und geht mit den beiden in die Küche. Später wird er Janina fragen, was es mit den Medikamenten in ihrem Zimmer auf sich hat.
Im Eingangsbereich hängt ein Foto des Teams, daneben sind einzelne Worte aufgeklebt: Umsorgen steht da, trösten, Grenzen setzen, beraten, erklären, stützen, schimpfen, reden, auf andere Ideen bringen – und auch lachen. „In den Jugendlichen steckt so viel Leben drin“, sagt Leiterin Rasch. „Die zeigen immer wieder, dass sie nicht nur von den Krisen bestimmt werden, obwohl grad alles scheiße ist.“
Das Schwierigste an ihrem Job? Rasch überlegt einen Moment. „Das Aushalten“, antwortet sie nach einer kurzen Pause. „Dass wir die Situation oft nicht ändern können und dabei zugucken müssen.“ Manche Mädchen sind „Systemsprengerinnen“ – für sie gibt es keine passende Bleibe. Andere steigen hergerichtet in ein teures Auto, das vorfährt. Die Mitarbeitenden müssen sie ziehen lassen. Wenn ein Mädchen gehen will, kann es gehen. Die Tür ist jederzeit offen – in beide Richtungen.