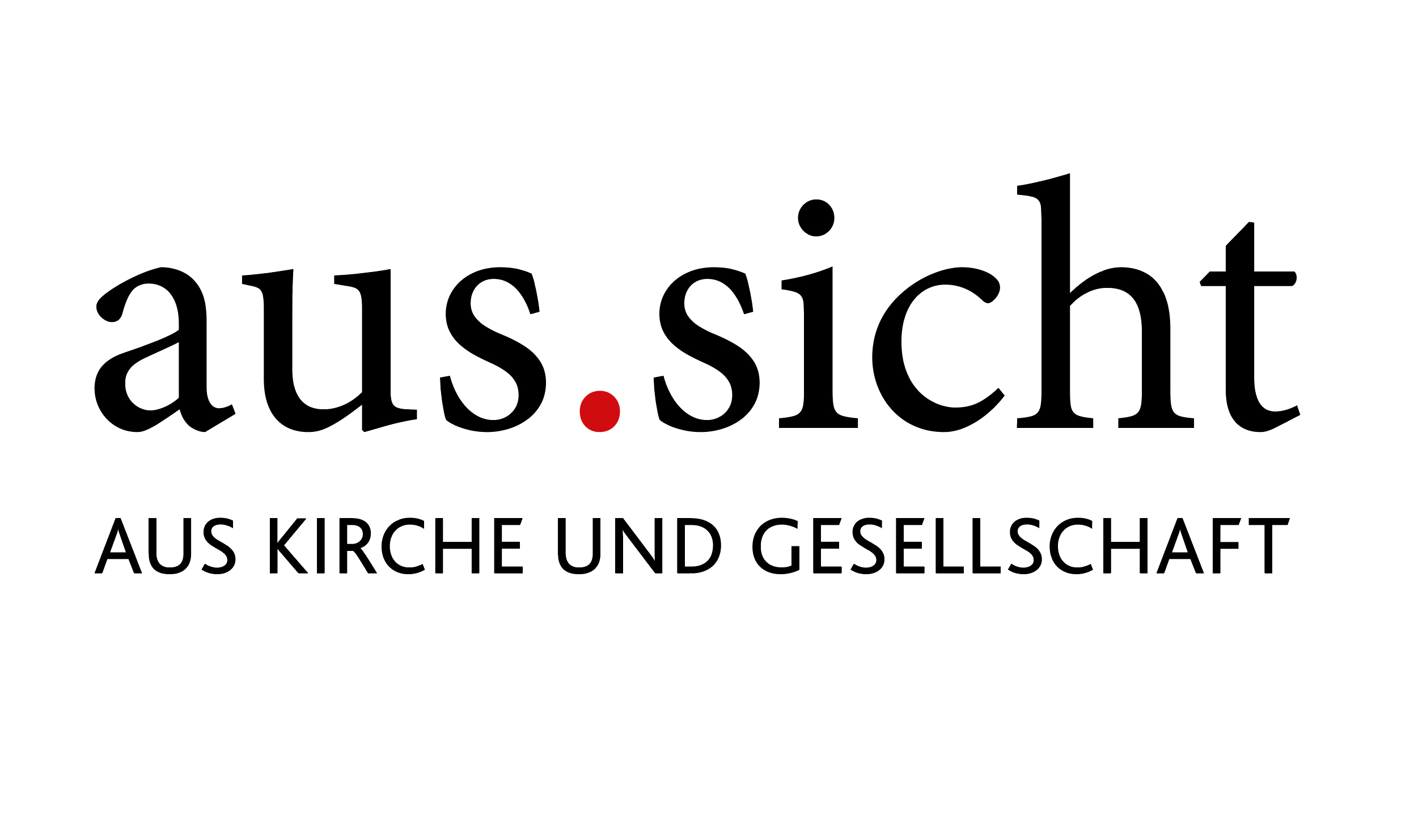Ein Besuch bei der katholischen Seemannsmission in Hamburg
Ein Ankerplatz für die Seele

Foto: privat
Nahe der Seemannsmission hat man eine gute Aussicht auf die Hamburger Elbphilharmonie. Von links: Lejla Klüssendorf, Monica Döring und Ritchille Salinas
Sie transportieren unseren täglichen Bedarf über Tausende Kilometer und halten unsere Wirtschaft am Laufen. Sie haben selten festen Boden unter den Füßen. Sie haben ein Zuhause, sind aber nur wenige Monate dort. Bei der Seemannsmission in Hamburg werden aus Männern der Schiffsbesatzungen Menschen. Dort sprechen sie über ihre Heimat, ihre Kinder und ihren schweren Beruf.
Sie ziehen ihre Stahlkappenschuhe an und die orangen Jacken mit Leuchtstreifen. Sie hängen sich ihren Ausweis mit Namen, Foto und Stella-Maris-Logo um den Hals. Dann fahren sie mit den Autos zu den Terminals im Hamburger Hafen.
Monica Döring ist die Leiterin der Katholischen Seemannsmission Stella Maris in Hamburg. Sie und ihre Mitarbeiterin Lejla Klüssendorf gehen als Seelsorgerinnen an Bord der Schiffe. Heute werden sie von einem ehrenamtlichen Mitarbeiter begleitet.
Zwei bis drei Schiffsbesuche hat Klüssendorf an diesem Morgen für jede von ihnen eingeplant. Auf einer Internetseite recherchiert sie zu Arbeitsbeginn, welche Schiffe von woher mit welcher Art von Fracht in den vergangenen Stunden im Hafen angekommen sind und an welchen Terminals sie liegen. Aus den Daten der Seemannsmission erfährt sie, wann zuletzt Seelsorgerinnen und Seelsorger an Bord waren. Dann entscheidet sie, welche Schiffe sie besuchen.

Die vier Besatzungen wissen nicht, dass sie auf der Besuchsliste der Seemannsmission stehen. Auch die Seelsorgerinnen wissen nicht, wen sie treffen, ob die Schiffscrew Zeit hat oder welche Gespräche sich ergeben. Seelsorge für Seeleute ist nicht planbar. Einige werden sich freuen, dass sie mit den Seelsorgerinnen über sich und ihre Familie sprechen können. Am Vortag hat Klüssendorf spontan einige Seeleute mit dem Kleinbus zum alten Elbtunnel gefahren, von wo aus sie eine kurze Stadtbesichtigung machen konnten. Auch das gehört zu ihrer Arbeit. Zu Fuß hätten sie den Weg in ihren wenigen Stunden Freizeit nicht geschafft.
Sonntags bietet die Seemannsmission einen Shuttle zum Gottesdienst an. Ein großer Teil der Menschen auf den Schiffen stammt von den Philippinen und ist katholisch. Wer sich meldet, wird mit dem Kleinbus zum Gottesdienst der philippinischen Gemeinde in Hamburg gefahren. Der Pfarrer der philippinischen katholischen Mission in Hamburg, Pater Ritchille Salinas, ist für die Seeleute zuständig und macht auch spontane Gottesdienste an Bord möglich.
Diese seien immer extrem wichtig, wenn auf dem Schiff ein Notfall war, berichtet Monica Döring: „Wenn da jemand verunglückt ist oder jemand gestorben ist, dann werden wir angesprochen. Wir haben Besatzungen von Schiffen getroffen, die lagen in Odessa, während die Raketen über ihnen geflogen sind. Und die Seeleute haben uns gefragt: ‚Wo können wir in die Kirche gehen?‘“
Die Zeit im Hafen ist oft die stressigste Zeit
Klüssendorf ist am Terminal eines großen Agrarunternehmens angekommen. Sie setzt ihren Helm auf. Die letzten Meter vom Auto zum Schiff sind ein schmaler Pfad zwischen der Kante des Kais und den Schienen, auf denen sich der Kran bewegt, der das Schiff belädt. Wer hier nicht aufpasst, riskiert, in den Spalt zwischen Kaimauer und Schiff zu stürzen. Über Unfälle von Seeleuten gibt es keine verlässlichen Statistiken. Doch die Mitarbeiterinnen der Seemannsmission zählen sie zu den alltäglichen Risiken für Seeleute.
Am Kai liegt der Getreidefrachter, dessen Kammern über einen Schlauch mit Weizen gefüllt werden. Die philippinischen Seeleute haben eine Gangway, eine Brücke ins Schiff gebaut, auf der es auch für Seelsorgerin Klüssendorf steil nach unten geht. Einen Handlauf gibt es nicht, nur links und rechts zwei locker hängende Seile.
Klüssendorf war gestern schon hier, kurz nachdem das Schiff angelegt hatte, und brachte die Infotüte der Seemannsmission mit den Telefonnummern und den Facebook-Adressen der Mitarbeiterinnen vorbei. Facebook, so berichtet sie, ist das üblichste Kommunikationsmittel der Seeleute. Die Mitarbeiterinnen der Seemannsmission nutzen das Netzwerk dienstlich. Mit ihrem Namen und ihrem Foto können sie von den Seeleuten leicht gefunden werden und Nachrichten mit ihnen austauschen. Von der Mannschaft des Getreidefrachters haben einige um kleine Holzkreuze gebeten.
Doch gerade haben die Seeleute keine Zeit. Sie sind am Ende einer Feuerübung und rollen die Löschschläuche an Deck zusammen. Klüssendorf beschließt, in der Schiffsmesse zu warten. Der blankgeputzte und aufgeräumte Essens- und Aufenthaltsraum an Bord lässt sie ahnen, dass an diesem Vormittag nicht nur die Feuerübung auf dem Programm stand. Wie ihr die Seeleute später bestätigen, kam auch die Hafenstaatkontrolle vorbei. Sie überprüft den technischen Zustand und die Sicherheit des Schiffes und die Arbeitsbedingungen der Besatzung. Auch der Zoll, die Seefahrergewerkschaft und die Umweltkontrolle kommen im Hafen auf die Schiffe.
Die Zeit im Hafen ist meist die stressigste Zeit für die Mannschaften. Auf dem Getreidefrachter sehen sie alle müde aus. Ein AB, ein Seemann mit dem niedrigsten Rang, erzählt Klüssendorf nach der Feuerübung, dass er jetzt um 11 Uhr eigentlich gar nicht an Deck wäre, weil seine Schicht erst um 12 Uhr beginnt. Wegen der Übung fiel seine sechsstündige Pause am Vormittag einfach aus. Von 6 Uhr früh bis 18 Uhr wird er also im Dienst sein. Dann hat er bis Mitternacht Zeit für sich, bis zur nächsten Schicht.
Im Hafen gibt es auf den meisten Schiffen einen Sechs-Stunden-Rhythmus mit vier Schichten: sechs Stunden Dienst, sechs Stunden Freizeit, dann wieder sechs Stunden Dienst und sechs Stunden Freizeit. Lange am Stück schlafen können die Seeleute also nicht. Auf See gibt es manchmal einen Acht-Stunden-Rhythmus, den finden viele angenehmer.
Klüssendorf überreicht einem der Seemänner eine ganze Tüte Holzkreuze. Er soll sie an die Kollegen weitergeben, die danach gefragt hatten. Dann packt sie die bestellten SIM-Karten aus. Die Seemannsmission unterstützt Seeleute dabei, bezahlbare Prepaid-Guthaben fürs Internet zu bekommen. Die sind wichtig, denn WLAN auf Frachtschiffen ist keine Selbstverständlichkeit. Es kommt häufig vor, dass Seeleute ohne Prepaid-Guthaben Tage und Wochen keinen Zugang zum Internet und damit keinen Kontakt mit ihren Familien und Freunden haben.
Bevor sie sich verabschiedet, fragt Klüssendorf die Philippinos noch, wie sie Sinulog gefeiert haben. Der Feiertag ist dem Jesuskind gewidmet und wird in ihrer Heimat im Januar mit Tanz, bunten Kleidern und Prozessionen begangen. Sie berichten ihr, dass sie während der Feiertage in einem europäischen Hafen waren und leider nicht feiern konnten. Einer zuckt bedauernd mit den Schultern. Über Videotelefonie konnte er zumindest ein bisschen am Fest der Familie teilhaben. Er zeigt der Seelsorgerin ein Foto auf dem Handy und strahlt, weil er mit ihr über etwas aus seiner Heimat sprechen kann.
Die Verbindung nach Hause hängt vom WLAN ab
Klüssendorf kennt die wichtigsten Feiertage der Seeleute. „Alles, was wir machen, und alles in der Begrüßungstasche sind ja erst mal Türöffner, um ins Gespräch zu kommen und eine Vertrauensbasis zu haben, eine Verbindung“, sagt sie. Deshalb versuche sie auch in verschiedenen Sprachen kleine Worte wie Danke oder Tschüss zu sagen. Wenn ihr die Seeleute für die SIM-Karten danken, antwortet sie oft mit „walang anuman“. Das heißt „gern geschehen“ auf Tagalog, der Sprache der Philippinos. Sie freuen sich dann und entgegnen entzückt: „Oh, du sprichst Tagalog!“
Mit dem Auto fährt Klüssendorf zum nächsten Schiff. Von der Brücke aus sieht man schon die schwarz-braune Staubwolke, die über dem Terminal hängt. Hier werden Kohle und Erze umgeschlagen. Gegenüber dem Schiff am Kai liegt das Schüttgut auf großen Halden. An der Kleidung der Seeleute und an den Händen klebt schwarzer Staub. Klüssendorf meldet sich beim Ersten Offizier und übergibt die Begrüßungstasche. Er bedauert, dass die Mannschaft die Seelsorge nicht mehr nutzen kann. Die Ladung ist fast abgeschlossen. Sie haben Eisenstaub aufgenommen und legen in zwei Stunden ab.
Der Offizier muss nun die Abfahrt vorbereiten und Schlepper ordern. Draußen an Deck steht Francis. Als OS, Ordinary Seaman, hat er schon einen höheren Rang in der Mannschaft. Auch er kommt von den Philippinen und heißt eigentlich anders. Wie viele Seeleute möchte er seinen Namen und den Namen des Schiffes nicht in der Zeitung veröffentlicht wissen. Er fürchtet, von der Reederei nicht mehr unter Vertrag genommen zu werden, wenn er mit der Presse Kontakt gehabt hat.
Francis hat den Kopf voll. Seine Tochter wird bald sieben Jahre alt. Mit seinem Gehalt sorgt er dafür, dass sie auf den Philippinen eine gute Schulbildung bekommt. Vor wenigen Wochen hat seine Familie den Auftrag bekommen, zusammen mit einer anderen eine traditionelle Spendenaktion der Schule zu organisieren. Blumenschmuck, Musik, Essen und ein Kleid für seine Tochter mussten her. Francis zeigt Klüssendorf Bilder auf dem Handy. Als er zu den Fotos von der Spendenaktion mit seiner Tochter im Prinzessinnenkleid kommt, wirkt er genervt. Aus seiner Sicht ist es eine unnötige Veranstaltung. Doch er konnte nichts dagegen tun. Er ist weit weg.
Was die Seeleute im Monat verdienen, hängt von ihren Verträgen mit den Reedereien oder Agenturen ab. In der untersten Gehaltsklasse können es 500 oder 800 Dollar im Monat sein. Das ist mehr, als sie in ihren Heimatländern verdienen würden. Dafür gehen viele neun Monate an Bord und kehren danach für ein oder zwei Monate zu ihren Familien zurück. Francis ist sehr zufrieden mit seinem Job. Seit sieben Jahren arbeitet er bei seiner Reederei, und er hat immer WLAN an Bord. Die gelbe Arbeitskleidung mit den Leuchtstreifen und die Helme mit Ohrenschützern könnten ein Hinweis sein, dass die Sicherheitsbestimmungen auf diesem Schiff ernster genommen werden. Klüssendorf fällt auf, dass der Erste Offizier ein Crewmitglied mit Vornamen statt nur mit AB angesprochen hat; das lässt sie hoffen, dass auf diesem Schiff auch ein besseres soziales Klima herrscht.
Die Seeleute mit ihren Namen anzusprechen – allein das ist für die Mitarbeiterinnen der Seemannsmission schon Seelsorge. Für Monica Döring bedeutet das, sie „als Christus zu sehen“ und ihnen zu zeigen: „Du bist mein Gegenüber, du mit deinem Namen bist mir wichtig und nicht nur dein Rang.“
Das Privatleben der Seeleute und ihre Probleme zu Hause dürfen an Bord keine Rolle spielen. „Manchmal habe ich den Eindruck, viele Seeleute haben sich so eine Art Panzer zugelegt“, sagt Klüssendorf. Innerhalb einer Besatzung werde oft nur oberflächlich miteinander gesprochen. Und „Politik ist ganz heikel, gerade wenn es um den Ukraine-Krieg geht“. In den internationalen Besatzungen sind auch russische und ukrainische Seeleute. Klüssendorf erzählt, dass viele Seeleute sagen: „Wir sprechen nicht über Politik. Wir sind hier zum Arbeiten. Nur zum Arbeiten.“ Eine Schiffsmannschaft muss funktionieren; zu gefährlich kann es auf hoher See werden, wenn nicht alle zusammenarbeiten.
Seeleute sind monatelang auf See. Da können auch Mobbing und sexuelle Belästigung zum Problem werden. Die Mannschaft auf Frachtschiffen – manchmal um die 30 Personen oder weniger – „ist halt eine sehr kleine Gruppe“, sagt Döring. „Es kann sein, dass du da keinen Freund hast und ganz alleine bist. Und du kannst nicht weg. Man ist dem schon ziemlich ausgeliefert. Wenn ständig jemand dich blöd anguckt, einen blöden Spruch macht oder du kriegst immer nur die blödesten Arbeiten – das macht das Leben zur Hölle.“

Ein Landgang oder der Besuch von einem Seemannsklub können, so Döring, „ein ganz großes Ventil sein“. Einfach, „dass du weg bist vom Schiff, mal andere Leute triffst“. Im Hamburger Hafen gibt es den Seemannklub Duckdalben der evangelischen Seemannsmission. Dort ist Platz zum Essen, Trinken und Zusammensitzen.
Drei Seeleute aus Mazedonien sind an diesem Tag in den Klub gekommen. Sie holen sich von der Theke Bier und Bockwurst mit Brot. Sie wollen in ihrer Freizeit einfach ein paar Stunden unter sich sein und sprechen Mazedonisch miteinander. Auf Fragen antworten sie nur knapp. Einer erzählt, dass er drei Kinder hat und deshalb auf dem Schiff arbeitet. Und das Gehalt? „Es reicht, ich bin zufrieden“, sagt er.
Ein anderer Seemann nimmt sich eine der Gitarren, die an der Wand hängen, und beginnt etwas zu spielen, das wie ein Popsong klingt. Er erzählt, dass er aus Myanmar kommt und dass er seit 30 Jahren Gitarre spielt. An Bord könne er seine Gitarre jedoch nicht mitnehmen. Jetzt gerade aber haben seine Kollegen vom Schiff keine Zeit, sich hinzusetzen und mit ihm zu singen. Er hängt die Gitarre zurück an ihren Platz. Sie kaufen schnell noch ein paar Süßigkeiten. Dann fährt sie ein Mitarbeiter des Klubs zurück zu ihrem Schiff.
„Einer der gefährlichsten Jobs der Erde“
Auch Francis und seine Kollegen hatten heute keine Zeit, das Schiff zu verlassen. Gerne wären sie in die Stadt gegangen, doch ihr Terminal war frei, sie hatten keine Wartezeit. Und so hieß es: entladen, Frachträume putzen, neue Ladung aufnehmen und wieder abfahren. Das alles in zwölf Stunden. Francis sagt: „Die Kräne hassen uns. Die wollen, dass wir schnell wieder weg sind.“ Er lächelt, aber glücklich ist er nicht.
Klüssendorf versucht ihn zu trösten und erklärt ihm: „Ja, aber dafür lieben wir euch.“ Sie bedankt sich, dass er unseren Handel am Laufen hält. Doch er scheint den Dank gerade nicht aufnehmen zu können.
Selbst wenn der Vertrag und das Gehalt gut sind, selbst wenn es Landgang gibt, ist die Seefahrt „immer noch einer der gefährlichsten Jobs der Erde“, sagt Döring. Wenn sie philippinische Seeleute fragt, warum sie das machen, dann höre sie als Antwort immer: „Ich mache das für meine Familie. Ich mache das für meine Kinder, damit sie bessere Möglichkeiten haben und eine bessere Arbeit bekommen.“
Rosenkränze gesucht
Immer wieder bitten die Seeleute die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Stella Maris um Rosenkränze für ihr Gebet auf See. Daher freut sich die Seemannsmission über Spenden von Rosenkränzen. Wollen Sie helfen? Sie können nicht mehr genutzte Kränze per Post an folgende Adresse senden:
Katholische Seemannsmission „Stella Maris“, Ellerholzweg 1a, 20457 Hamburg