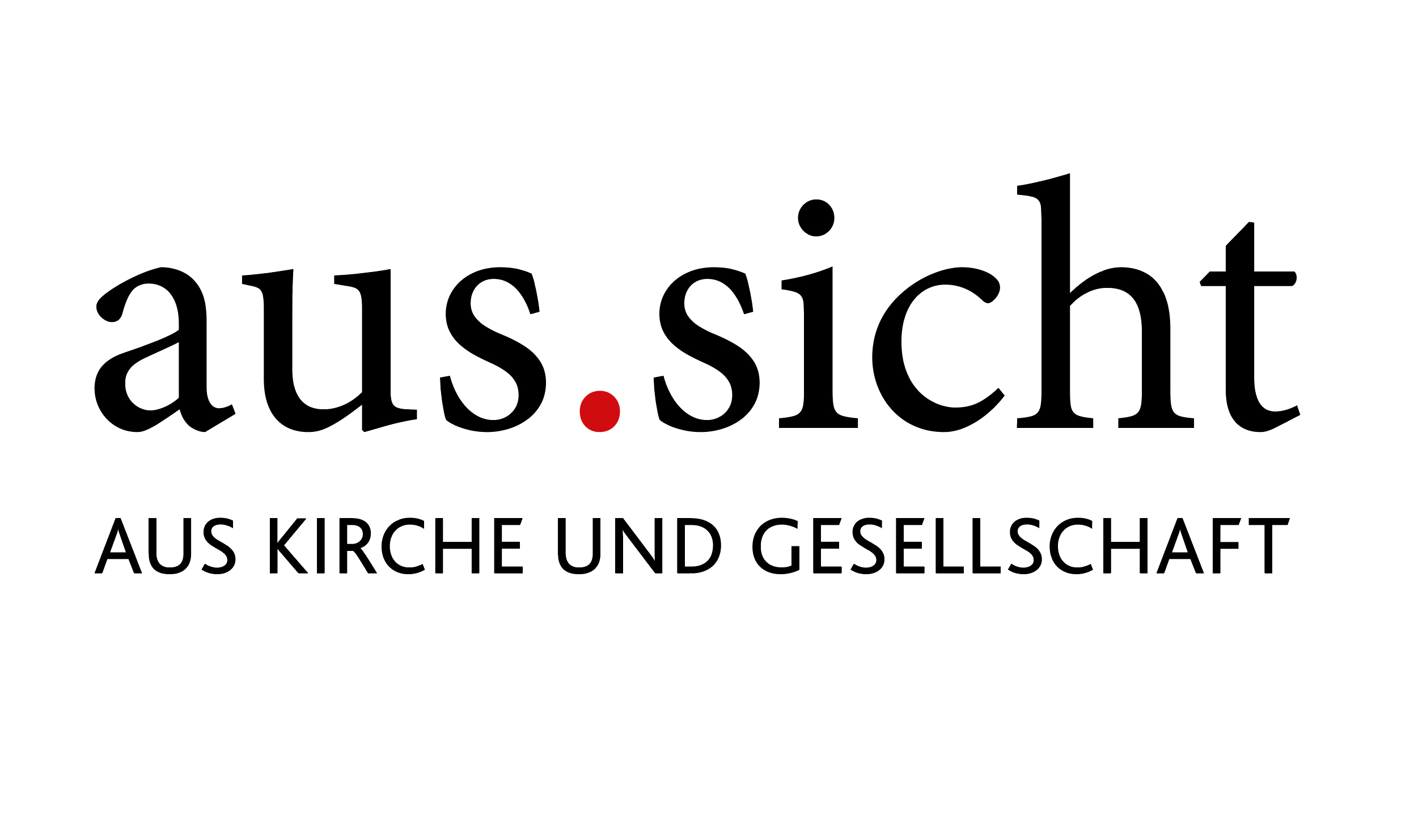Interview mit Dirk Bingener
"Es geht nicht darum, zu belehren, sondern zu lernen"

Foto: kna/Julia Steinbrecht
Worum geht es beim Weltmissionsmonat?
Es geht um Begegnung. Die Weltkirche ist ja ein wichtiges Thema in der derzeitigen kirchlichen Diskussion, aber sie ist für viele Menschen sehr abstrakt. Deshalb laden wir Projektpartner ein, die von weither kommen, in diesem Jahr aus Myanmar. Unter unseren Gästen sind Bischöfe, Priester und Ordensleute, die in ihrem Land auf der Flucht sind und Flüchtlingen beistehen.
Was wollen Sie damit erreichen?
Wir wollen Raum schaffen für deren Themen. Man kann von ihnen aus erster Hand erfahren, was es heißt, in Myanmar seinen Glauben zu leben – in einem Land, wo viele Menschen unter der Militärdiktatur leiden oder nach dem schweren Erdbeben im März in Zeltstädten ausharren.
Der Name Missio hat ja mit Mission zu tun. Worin besteht für Sie das Ziel von Mission?
Der heilige Franziskus soll einmal gesagt haben: „Verkündige das Evangelium, notfalls mit Worten!“ Unser Ansatz ist, die Welt im Sinne des Evangeliums umzugestalten, nicht zuerst mit Worten, sondern in der konkreten Tat. Das heißt beispielsweise, dass alleetwas zu essen haben, dass behinderte Menschen nicht ausgegrenzt, dass Kinder gefördert werden, dass Alte nicht vereinsamen – in all diesen Menschen begegnen wir Christus, in seinem Auftrag sind wir unterwegs.
Wie hat sich das Verständnis von Mission im Laufe der Zeit verändert?
Die Entstehung der Missio-Hilfswerke geht ja auf die selige Pauline-Marie Jaricot zurück. Sie wurde vor 190 Jahren sozusagen zur Mutter der Missionsbewegungen, indem sie deutlich gemacht hat, dass Mission nicht nur eine Sache des Klerus ist, sondern aller Christinnen und Christen. Das ist ein positiver Impuls, heute wie damals. Im Hinblick auf die Veränderung lässt sich sagen: In der Vergangenheit hat man zu stark betont, man müsse Gott und das Christentum zu den Menschen in Afrika, Asien und Ozeanien bringen, sie sozusagen bekehren. Da haben wir heute eine andere Auffassung.
Welche?
Dass Gott schon längst dort ist. Dass man also nichts bringen muss, sondern dass Gott bereits in Geschichte, Kultur und Religion der Menschen wirkt.
Was bedeutet das für die Mission?
Dass es darum geht, gemeinsam den Glauben zu entdecken und zu vertiefen. Es geht nicht darum, zu belehren, sondern zu lernen von den jeweiligen Kulturen, auf die man trifft. Heute ist die Weltkirche eine Lerngemeinschaft. Das ist eine wichtige Veränderung, vor allem in Abgrenzung zur Mission während der Zeit des Kolonialismus.
Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Projekte den Menschen etwas geben, was sie wirklich brauchen?
Es ist nicht so, dass wir die Projekte vorschlagen, sondern unsere kirchlichen Partner in den Projektländern machen Vorschläge. Wir kommen nicht mit einer Agenda, sondern die Menschen vor Ort wenden sich an uns. Wir hören ihnen sehr lange zu, um zu verstehen, was wichtig ist.
Wie reagieren die Projektpartner auf die Unterstützung aus Deutschland?
Das Erste, was sie sagen, zum Beispiel bei meinem Besuch in Myanmar, ist: „Dass ihr euch auf den Weg gemacht habt und zu uns gekommen seid, das ist das Allerwichtigste. Es zeigt uns, dass wir nicht alleine sind.“ Natürlich sind Spenden wichtig. Noch wichtiger aber ist es, den Menschen ein Zeichen zu geben, dass sie nicht vergessen sind und dass sie Schwestern und Brüder in Deutschland haben.
Wie schaffen Sie es, Spenden zu sammeln und Menschen für Ihre Anliegen zu gewinnen?
Viele Menschen in Deutschland sind sehr großzügig und wollen etwas Gutes unterstützen. Und viele erleben die Kirche im globalen Süden als eine authentische Kirche, eine Kirche der Armen. Dafür wollen sie sich engagieren. Und das geht auf verschiedene Art und Weise, auch durch Spenden – analog und digital.
Auf welche Weise noch?
Bei der Aktion Schutzengel geht es beispielsweise darum, alte Handys zu sammeln, damit die wertvollen Metalle darin wiederverwertet werden können. Damit hängt die Tatsache zusammen, dass unser Elektroschrott in Ghana landet und Menschen und Umwelt vergiftet. Darunter leiden unsere Schwestern und Brüder. Viele hierzulande fühlen sich daher mitverantwortlich, wollen ihr Konsumverhalten ändern und so die Situation zum Besseren wenden.
Haben Sie den Eindruck, dass Sie mit Ihrer Arbeit etwas verändern können?
Davon bin ich überzeugt. Das eine ist die Unterstützung der konkreten Projekte unserer Partner, das andere ist die gelebte Solidarität mit unseren Geschwistern auf der ganzen Welt: im Gebet und im Engagement.