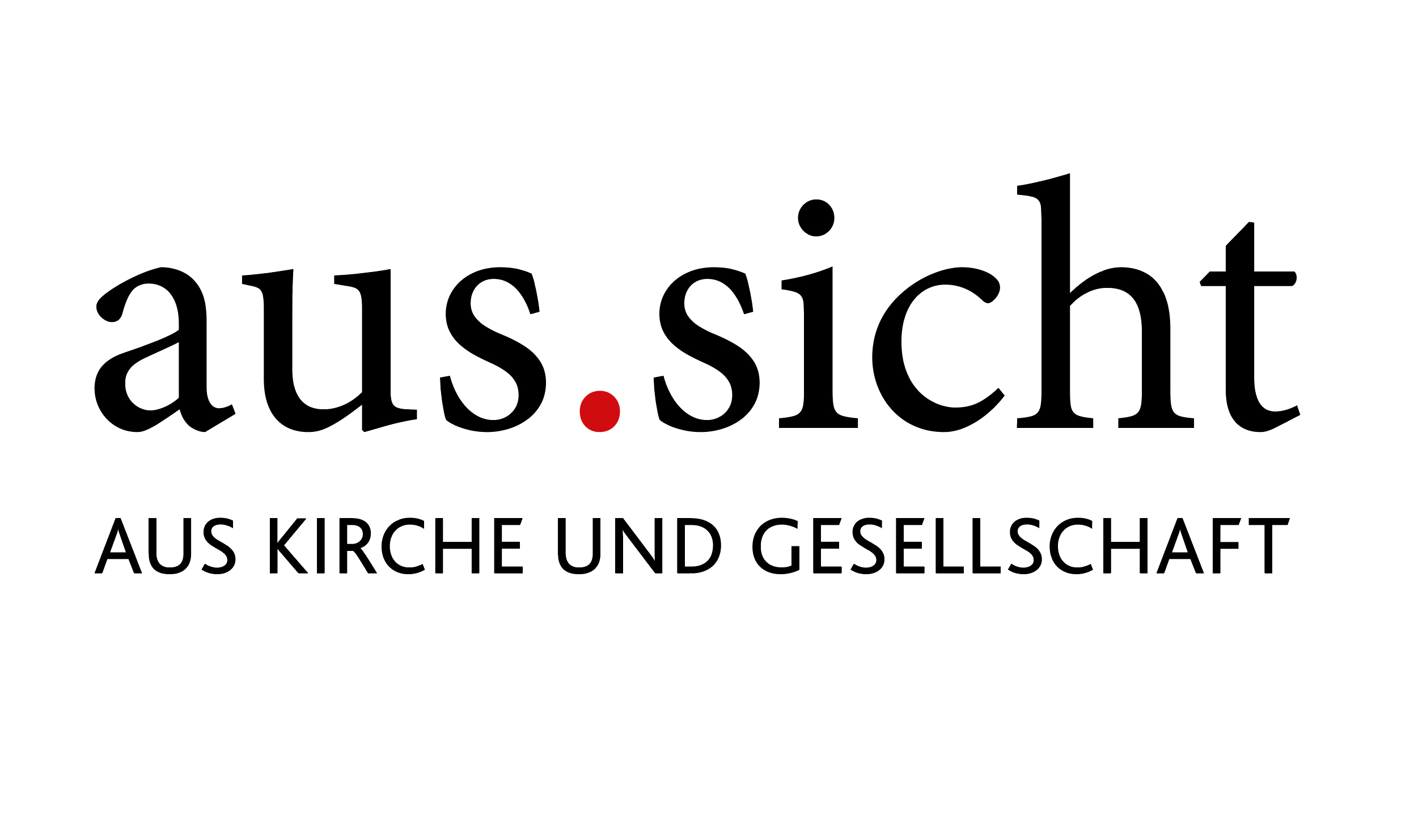Schwach besuchte Gottesdienste: Gemeinden müssen sich weiterentwickeln
Kirche braucht mehr Glaubensorte

kna/Harald Oppitz
Vielfältiger Glaube: Wer sich von christlichen Angeboten, in diesem Fall ein Berggottesdienst, berühren lässt, gehört zu Jesu Nachfolgern – auf seine ganz eigene Art.
Jahrzehntelang war in vielen katholischen Familien ein Termin in der Woche gesetzt: Sonntag, 10 Uhr, Gottesdienst. Dort traf man den halben Ort – vom Kleinkind bis zum Opa. Kirche fühlte sich an wie eine große Familie, die miteinander feiert. Dieses Gefühl gibt es nicht mehr. Seit Jahren werden die Gottesdienste leerer, Corona hat diese Entwicklung noch beschleunigt. Die aktuelle Kirchenstatistik, die in dieser Woche veröffentlicht wurde, hat den tristen Trend erneut belegt. Viele Gläubige schmerzt er.
Was aber können Gemeinden tun? Der Theologe Björn Szymanowski sagt: „Sie haben ihre Zukunft nicht allein in der Hand, aber sie sind ihrem Schicksal auch nicht hilflos ausgeliefert.“ Er beschäftigt sich am Zentrum für Angewandte Pastoralforschung in Bochum mit dem Thema Kirchenentwicklung und erläutert, an einigen gesellschaftlichen Entwicklungen könnten Gemeinden nichts ändern. Etwa daran, dass sich viele Menschen vom Glauben entfremden. Studien zeigten, dass Gemeinden für viele Milieus uninteressant sind, sagt Szymanowski. Die Engagierten sollten wissen: „Sie können die Kirchenkrise nicht allein bewältigen. Egal wie sehr sie sich anstrengen: Sie werden nicht jeden Menschen erreichen.“
Und doch sollten Gemeinden sich weiterentwickeln, sagt Szymanowski: „Sie müssen darüber nachdenken, welche Bedürfnisse die Leute haben, die da sind, welche neuen Formate es geben kann.“ Er erzählt, in einem Projekt im Bistum Speyer hätten Gläubige Feedback zu Predigten geben können. Der Priester sei dadurch mit mehr Lust und Respekt an die Arbeit gegangen, und die Gemeindemitglieder hätten gesagt: „Cool! Danke, dass ihr gefragt habt! Ich habe noch mehr Ideen, die ich gern einbringen würde.“ So könnten Vertrauen, Zufriedenheit und ein Miteinander wachsen.
Zugleich, so Szymanowski, müsse man die Frage, was Zugehörigkeit zu einer Gemeinde definiert, neu denken. Früher gehörte man entweder ganz dazu oder gar nicht. Heute nutzen viele punktuell ein Angebot – und erst Monate später das nächste. Bei den Jüngern in der Bibel, sagt Szymanowski, habe es auch verschiedene Formen der Nachfolge gegeben: „Einige sind nur ein Stück mitgekommen und dann wieder gegangen.“ Auch wir müssten nicht jeden in die Institution Kirche integrieren. Wichtiger sei es, Menschen in Kontakt zur christlichen Botschaft zu bringen.
Die Kirche, betont der Theologe, solle dafür Glaubensorte auch jenseits der klassischen Gemeinde aufbauen. Angebote wie das Weihnachtslob in Erfurt – eine Weihnachtsfeier für Nichtchristen und Menschen, die mit der katholischen Liturgie nicht vertraut sind. Oder Segensfeiern für Neugeborene von Eltern, die noch nicht wissen, ob sie ihr Kind taufen lassen wollen. Oder das Aschekreuz to go. Oder das Projekt Surf & Soul im Erzbistum Berlin, das Wassersport mit Spiritualität verbindet.
All die Menschen, die sich von diesen Angeboten berühren lassen, gehören zu Jesu Nachfolgern – auf ihre Art. Wer das bedenkt, den schmerzt ein schwach besuchter Gottesdienst vielleicht nicht mehr ganz so sehr.