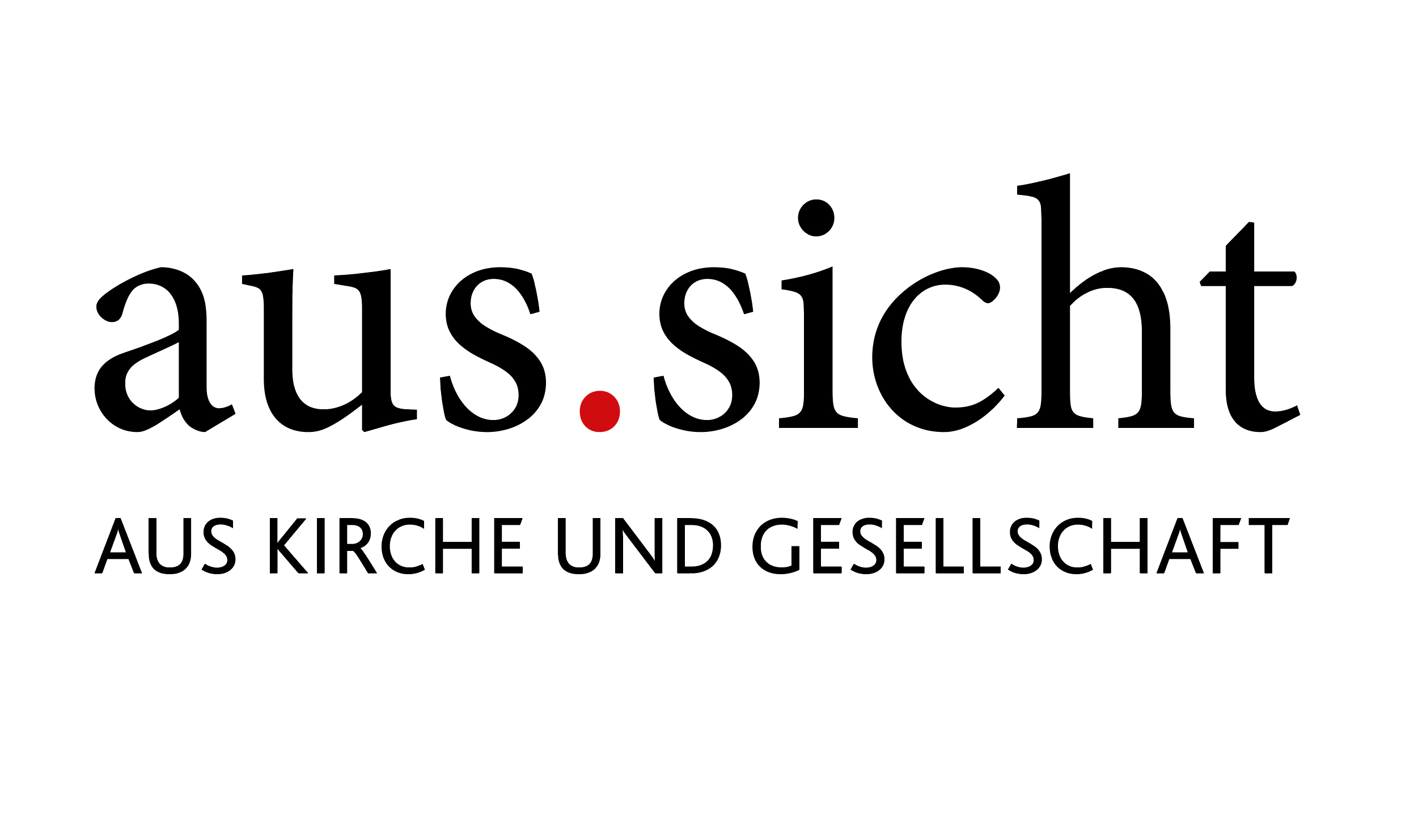Zwei Friedensaktivisten der „Combatants for Peace“ werben in Leipzig für Frieden im Nahen Osten
Im Kampf für den Frieden

Foto: Stefan Schilde
„Im Gegenüber den Menschen sehen“ – das wünschen sich der Palästinenser Osama Iliwat (45) und der Israeli Rotem Levin (33).
Immer, wenn bei einer Veranstaltung ein Polizeiwagen vor dem Gebäude steht, scheint klar zu sein: Das Thema muss es in sich haben. So auch an diesem Abend in der Leipziger Propsteigemeinde St. Trinitatis. Zu Gast waren die beiden Friedensaktivisten Osama Iliwat und Rotem Levin, ein Palästinenser und ein Israeli, die derzeit durch Deutschland touren, um auf ihren Einsatz für den Frieden in Nahost aufmerksam zu machen. „Combatants for Peace“, heißt ihre Organisation – „Kämpfer für den Frieden“.
Auf unterschiedlichen Wegen Friedenskämpfer geworden
Der Abend vor 200 Gästen im vollen Saal der Propsteigemeinde war gegliedert in zwei Halbzeiten. Im ersten stellten sich die beiden Aktivisten vor, erzählten über ihr Leben und ihren Werdegang zu „Friedenskämpfern“.
Rotem Levin berichtete, wie er als Kind aus einem Dorf nahe Tel Aviv zu den israelischen Soldaten aufsah. Wie er eine rein jüdische Schule besuchte und keinen echten Kontakt zur arabischstämmigen Bevölkerung hatte. Wie er sich voller Begeisterung bei der Armee einschrieb und als Soldat zum ersten Mal das besetzte Westjordanland betrat. „Obwohl keine Gefahr erkennbar war, warf ich auf Befehl eine Handgranate“, sagte er. Im Nachhinein wuchsen ihm die Zweifel. Nach drei Jahren quittierte er seinen Dienst und begab sich auf Reisen. „Um eine andere Einstellung zu erlangen, um wieder zu lernen, eigene Entscheidungen zu treffen“, sagte er. Vor allem die Zeit, die er auf Reisen in Deutschland verbrachte, habe seine Geisteshaltung verändert. „Er habe viele intensive Gespräche mit Palästinensern geführt“, so Levin. 2017 trat er den „Combatants“ bei.
Der in Jericho im Westjordanland lebende Osama Iliwat erlebte Anfang der 90er Jahre schon die erste „Intifada“. Intifada, so nennen die Palästinenser ihre gewaltsamen Aufstände gegen Israel. Während der zweiten Intifada in den 2000er Jahren sei er inhaftiert worden, weil er mit Freunden aus T-Shirts eine übergroße Palästina-Fahne genäht und an einem Baum gehängt habe. In den neun Monaten Gefängnis habe er begonnen, „die Juden zu hassen“. Ein Umdenken brachte 2010 ein Treffen mit israelischen Aktivisten: „Ein Freund hatte mich mitgenommen. Ich war erstaunt, dass Juden kritisch über Besatzung, Siedlungsbau und Diskriminierung sprachen.“ Zuvor habe er Juden nur in Uniform gekannt. „Als Soldaten, die auf uns schossen oder uns verhafteten“, sagte Iliwat.
Auf die eindrucksvollen Erzählungen der Friedensaktivisten folgte eine zehnminütige „Resonanzpause“, in der das Publikum seine Fragen an die Aktivisten niederschreiben und in die Kollektenkörbe einwerfen konnte. Im zweiten Teil nahm der Abend dann an Fahrt auf, denn viel deutlicher als vorher machten Levin und Iliwat bei der Beantwortung der Fragen ihrem Unmut über die israelische Politik Luft. Dafür holten sie weit aus: Die „Nakba“, Vertreibungsaktionen gegen die arabische Bevölkerung im Krieg nach der Staatsgründung Israels wurden ebenso ins Feld geführt wie die Besetzung von Teilen des Westjordanlands, Gazas und weiterer Gebiete. Näheres zu den Umständen, wie es dazu kam, erfuhren die anwesenden Gäste allerdings nicht. Überhaupt beschränkte sich die Kritik der beiden weitgehend auf von Israel begangene Fehltritte und Verstöße gegen internationales Recht.
„Apartheid“: die israelische Politik bekommt ihr Fett weg
Das Publikum blieb angesichts der drastischen Schilderungen nicht ungerührt. Ein Raunen der Empörung ging durch den Saal, als Levin sagte: „Ich als israelischer Jude kann hier frei reden. Mein Freund Osama könnte sich das nicht erlauben.“ Dass sein Freund als Aktivist schon seit Jahren die ganze Welt bereist, israelkritische Vorträge wie in Leipzig hält und nach wie vor auf freiem Fuß ist, ficht da niemanden an. Stattdessen: eifriges Kopfnicken, als Iliwat empfahl, sich besser über alternative Quellen zu informieren, nicht „über von der Regierung gestützte Medien“. Vom Zuspruch ermuntert, war es Levin, der meinte: „Was Israel macht, ist Apartheid.“
Spätestens an dieser Stelle hätte sich mancher Zuhörer womöglich Gelegenheit gewünscht, spontane Rückfragen zu stellen. Doch kritisches Nachhaken schien nicht erwünscht. „Wir sind heute als Lernende hier, die zuhören“, hatte Propst Gregor Giele schon in seiner Begrüßung gesagt. „Politische Statements“ wolle man heute Abend nicht. Oder wie es Osama Iliwat mit reichlich Ironie ausdrückte: „Wenn jemand denkt, dass er über die Lage dort besser Bescheid weiß als wir, sind wir gern für Diskussionen offen.“
Immerhin schafften es auch skeptische Fragezettel in die Auswahl. Wie ein dauerhafter Frieden denn gewährleistet werden könnte, wollte einer wissen. Einstaatenlösung? Zweistaatenlösung? „Wie genau die Lösung aussieht, ist weniger wichtig“, meinte Osama Iliwat. Es komme vielmehr darauf an, dass Israel „gezwungen wird, die Abmachungen endlich einzuhalten“. Auch Rotem Levin hatte einen Vorschlag: „Der Westen muss aufhören, Israel mit Waffen zu unterstützen. Diese helfen nicht Israel, sondern nur der Hamas.“ Auch die Deutschen sollten ihre Regierung dafür unter Druck setzen.
Einen wunden Punkt traf die Frage, wie es derzeit um die palästinensisch-israelische Friedensbewegung bestellt sei. „Überhaupt nicht gut“, sagte Levin. Viele Friedensaktivisten hätten nach dem Hamas-Angriff auf das Musikfestival ihre Meinung geändert und würden nun den Einsatz des Militärs befürworten oder zumindest hinnehmen. „Vielen gelten wir als naiv, manche rufen mir entgegen: ‚Du unterstützt den Feind!‘“ Das alljährlich von „Combatants for Peace“ organisierte Gedenken, das – im Gegensatz zum gleichzeitig stattfindenden israelischen Nationalfeiertag – auch den Palästinensern Platz für ihren Schmerz gibt, droht wegen der aufgeheizten Stimmung im Land auszufallen.
Entmutigen lassen wollen sich die beiden davon nicht. „Dass so viele Menschen ihre Zeit aufwenden und hierherkommen, um uns zuzuhören, macht mir Hoffnung“, sagte Osama Iliwat. Und tatsächlich: Ihr Auftritt dürfte den beiden Unterstützung eingebracht haben, die Sympathie unter den Gästen war, wie der demonstrativ lange Applaus verriet, sichtlich und hörbar groß. „Druck auf die Politik erzeugen“, hatten die beiden Aktivisten als Ziel ausgegeben. Die Postfächer der Politiker könnten demnächst gut gefüllt sein – jedenfalls die Postfächer deutscher und israelischer Politiker.
Meinung: „Leider nur die eine Sichtweise“
Bestimmt haben sie es beim Lesen des obigen Beitrags bemerkt: Ein nüchterner Bericht über die Veranstaltung in der Leipziger Propsteigemeinde wollte mir nicht so recht gelingen. Wie die meisten Deutschen habe auch ich eine Meinung zum Nahostkonflikt.
Vorweg: Ich finde es bewundernswert, wie Osama Iliwat und Rotem Levin sich dem Frieden im heiligen Land verschrieben haben. Es müsste viel mehr von ihrer Sorte geben und ich wünsche mir von Herzen, dass ihre Bemühungen Früchte tragen.

Redakteur
Allerdings habe ich nach der Veranstaltung meine Zweifel, dass es so klappen wird. Denn unter Frieden verstehe ich allgemein, dass beide Seiten ihre Perspektive einbringen können. Das war an dem Abend in Leipzig nicht der Fall.
Glaubt man den Aktivisten, ist vor allem Israel verantwortlich dafür, dass kein Frieden einkehren mag. Hörten Besatzung und illegaler Siedlungsbau auf, so die Botschaft, sei Frieden möglich. Nicht ein einziges Mal war von „Terrorismus“ die Rede – allenfalls von „gewaltsamem Widerstand“, der sich nicht gegen „Frauen, Kinder und Zivilisten“ richten dürfe. „Wohl aber gegen israelische Soldaten?“, fragte ich mich.
Bei aller Sympathie scheint mir diese einseitige Darstellung nicht geeignet, die Mehrheit der Israelis mit ins Boot zu holen. Ohne die wird es aber nicht gehen. Ich hatte mir von dem Abend erhofft, dass beide Seiten Raum bekommen. So durfte sich bestätigt sehen, wer Israel als Hauptschuldigen an der Misere ausgemacht hat. Wenn selbst der jüdische Israeli das so sieht, nicht wahr? Am Ende war die Stimmung bei einigen im Saal so emotional, dass sich bei mir ein flaues Gefühl in der Magengegend einstellte.
Wenn man es positiv sehen will: Befürchtungen, der Abend könnte – wie anderswo geschehen – wegen Protesten pro-palästinensischer Demonstranten gestört oder gar abgebrochen werden, haben sich nicht bewahrheitet. Das halbe Dutzend Polizisten draußen blieb beschäftigungslos