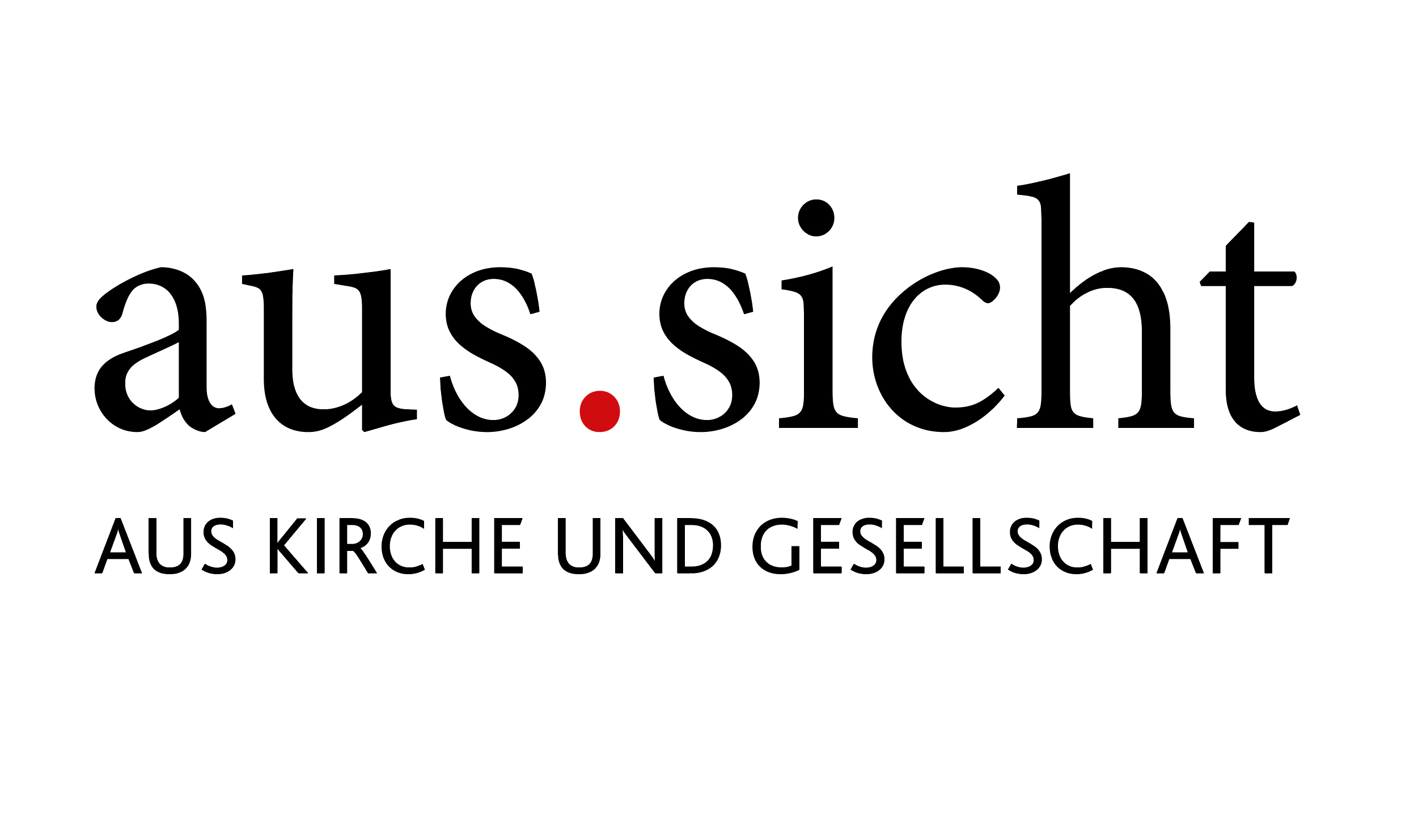Weihnachten
Friede auf Erden den Menschen

Illustration: Bitter/istock
Die Engel sprachen zu den Hirten auf dem Feld bei Betlehem: "Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens."
Frieden mit mir
„Ich muss mir immer wieder auf die Schliche kommen“
Es gibt Menschen, die können sich nur schwer konzentrieren. Sie beginnen zwei oder drei Aufgaben gleichzeitig, ohne eine zu Ende zu bringen. Sie wollen alles mitmachen, sind immer dabei – getrieben von der Angst, etwas zu verpassen. „Die packen sich ihren Terminkalender voll und stehen ständig unter Strom“, sagt Thomas Dienberg. Als Trainer, geistlicher Begleiter und Leiter von Exerzitien trifft der Kapuziner aus Münster immer wieder auf Menschen, die sich so unter Druck setzen. „Sie sind unruhig, unausgeglichen, gehetzt“, sagt er. Er hat dann den Eindruck: „Die halten es bei sich nicht aus. Ihnen fehlt der innere Frieden.“
Zufriedenheit, Ausgeglichenheit und Ruhe – das wünschen sich viele Menschen für ihr Leben. „Und es ist unglaublich wichtig für unser Wohlbefinden“, sagt Dienberg. Dabei klammert er nicht aus, dass es im Leben Krisen gibt, die nur schwer zu bewältigen sind. „Es ist nicht immer alles rosig. Aber innerer Frieden heißt für mich, mit mir selbst im Einklang zu sein“, sagt Dienberg.

Um die innere Balance zu bewahren, muss er aber etwas tun. „Der Frieden kommt nicht aus mir selbst, sondern aus einer Quelle“, sagt der Kapuziner. In seinem Fall sind es vor allem der christliche Glaube und die christliche Spiritualität. Ihm reicht es, sich für ein kurzes Gebet in die Kirche zurückzuziehen. „Oder einfach eine Runde um den Block laufen. Das hilft mir, mich wieder zu fokussieren. Und durchzuatmen“, sagt Dienberg. Der räumliche Wechsel sei aber wichtig: „Ich kann das nicht im Büro, selbst wenn ich die Tür schließe.“
„In Beziehungen zu leben, trägt zum inneren Frieden bei“
Manchmal reichen fünf Minuten aber nicht aus. Wenn Dienberg in einem Gespräch spürt, dass sein Gegenüber unruhig ist, fragt er vorsichtig nach: Was ist los bei dir? „Es ist wichtig, dieser Unruhe auf den Grund zu gehen“, sagt Dienberg. Dann braucht es manchmal ein Wochenende oder Exerzitien, die mehrere Tage dauern. „Sich neu auszurichten, ist ein Prozess“, sagt Dienberg. Und der kann schmerzhaft sein: „Wenn derjenige erkennt, dass er vor etwas davonrennt. Oder wenn man dem eigenen Ideal nicht gerecht werden kann. Oder wenn man spürt, dass einem nichts mehr Halt gibt.“ Wichtig sind dann Freunde und Familie. „In Beziehungen zu leben, trägt zum inneren Frieden bei“, sagt Dienberg. Es hilft, wenn jemand da ist, der die eigenen Gedanken reflektiert. „Ein Gespräch lässt manchmal eine andere Sichtweise erkennen“, sagt Dienberg.
Die Suche nach dem inneren Frieden – für Dienberg ist das ein lebenslanger Prozess. „Ich muss mir immer wieder auf die Schliche kommen, mich selbst überprüfen. Das kann durchaus mühsam sein“, sagt er. „Frieden heißt für mich, zu sehen, was mir in meinem Leben Mut macht und was gut ist. Und das zu sehen, was mir selbst an mir nicht passt. Wenn ich das weiß, kann ich meinen Frieden finden – und auch für andere zum Friedensbringer werden.“
Kerstin Ostendorf
Frieden in der Gesellschaft
„Oft steht nicht mehr der Hass auf die anderen im Vordergrund“
Ein Altenheim in Berlin. Junge und alte Menschen sitzen zusammen an festlich gedeckten Kaffeetischen. Die Jugendlichen engagieren sich bei der Gemeinschaft Sant’Egidio, manche leben als Geflüchtete in der Stadt. Sie teilen sich mit ihren Tischnachbarn Kaffee, Tee, Erinnerungen an Früher und später das Liedheft. Sie singen „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ und Lieder, die viele auswendig können. So wie in den letzten Jahren wird es auch an diesem zweiten Weihnachtsfeiertag sein. Dann gibt es keine Bedürftigen, keine Migranten, keine Menschen mit Demenz. Jede und jeder gibt und nimmt etwas und alle feiern Weihnachten.
Das ist das Wichtigste für Maria Herrmann und Alexander Linke. Die Grundschullehrerin und der Mathematiker sind seit Jahren Mitglieder von Sant’Egidio und organisieren nicht nur die Weihnachtsfeier in dem Altenheim. Dank vieler Spenden und mit vielen Ehrenamtlichen lädt die Gemeinschaft etwa 1000 weitere Gäste zum Weihnachtsessen ein: Kinder aus den Schulen des Friedens, mit ihren Eltern und Geschwistern.
Freundschaft wächst in den Schulen des Friedens
Die Schulen des Friedens sind eine Art Freizeitprogramm, das derzeit an einer Schule in Neukölln und an einem Geflüchtetenwohnheim in Marzahn angeboten wird. Dort kümmern sich Jugendliche jede Woche für etwa zwei Stunden um die Kinder, helfen ihnen bei den Hausaufgaben und machen gemeinsam Spiele oder Ausflüge. Viele der Kinder, die daran teilnehmen, sind mit ihren Familien aus Kriegsgebieten wie Syrien oder der Ukraine nach Berlin gekommen. Die Schulen des Friedens sollen sie unterstützen, Freunde zu finden, miteinander die Stadt kennenzulernen und am kulturellen Leben teilzunehmen – damit die Kinder „eine Chance haben im Leben“, wie Linke sagt.
„Die Probleme zwischen den verschiedenen Religionen und Kulturen begegnen uns tagtäglich seit vielen Jahren“
In Frieden miteinander zu leben, lernen sie in Neukölln und Marzahn nicht von allein. „Die Probleme zwischen den verschiedenen Religionen und Kulturen begegnen uns tagtäglich seit vielen Jahren“, sagt Linke. Zumindest latent seien die Spannungen immer dagewesen, sie zeigten sich nicht erst seit dem Krieg in Israel. In den Schulen des Friedens versuchen sie, über die Kinder auch mit den Eltern ins Gespräch zu kommen. Wenn die Erwachsenen merken, dass man ihnen zuhört, „dann ist es oft nicht mehr der Hass auf die anderen, der im Vordergrund steht“, sagt Linke. Stattdessen bricht aus den Menschen heraus, wie viel Angst sie um ihre Verwandten in Israel, in Gaza, in Syrien oder in der Ukraine haben.
Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag kommen sie bei Sant’Egidio alle zusammen – Kinder und Eltern mit vielen Sprachen, Religionen und Kulturen. In diesem Jahr wird es wohl Hähnchenschnitzel und etwas Vegetarisches zu essen geben, verrät Linke, also etwas, „das deutschen, türkischen, libanesischen, afghanischen Kindern und allen schmeckt“. Geschenke bekommen die Kinder auch. Dafür wählen die Ehrenamtlichen aus gespendeten Spielsachen für jedes Kind was Passendes aus. „Das ist eine Art und Weise, wie wir versuchen, die Gesellschaft mit friedlichen Mitteln menschlicher zu machen“, sagt Linke.
Barbara Dreiling
Frieden in Beziehungen
„Die kleinen, vorher so wichtigen Details verlieren an Gewicht“
Die Zahnpastatube liegt offen herum, die Socken sind im Weg und zack: Da sind sie wieder. Vorwürfe an die Partnerin oder den Partner, der sowieso nichts im Haushalt macht und nur faul herumsitzt. Vorwürfe wegen Kleinigkeiten, die immer wieder zum Streit führen. Reibereien, hinter denen etwas ganz anderes als die Zahnpastatube steckt, wie Monika Knauer-Walter sagt. Sie ist Vorsitzende des Bundesverbands Mediation. Als hauptberufliche Mediatorin schlichtet sie Streit zwischen Nachbarn, unter Kollegen oder in Familien.

„Mein Job ist es, die Menschen dabei zu unterstützen, herauszufinden, was sie wirklich bewegt. Was das Thema hinter dem Thema ist“, sagt Knauer-Walter. Hinter Vorwürfen gegen den Partner beispielsweise liegen häufig Bedürfnisse, die uns selbst gar nicht bewusst sind. Zum Beispiel fühlt sich die eine vom anderen nicht gesehen, hat den Eindruck, dass er nicht wohlwollend zu ihr spricht oder wünscht sich, dass er sich mehr Zeit für die Beziehung nimmt. Knauer-Walter versucht, diese Bedürfnisse an die Oberfläche zu holen, indem sie erst mal zuhört und das Gesagte nüchtern zusammenfasst. Dabei kommt dann vielleicht raus, dass die Zahnpastatube gar nicht das Problem ist, sondern dass jemand es einfach schön fände, wenn sein Partner sieht, dass das Bad geputzt ist.
Was beschäftigt eigentlich den anderen?
Wenn die Streitenden mit sich selbst und ihren Bedürfnissen in Kontakt kommen, fühlen sie sich verstanden, atmen durch, schauen sich wieder an oder weinen sogar. Dann spürt die Mediatorin, dass langsam Frieden wächst. „Wenn ich merke, dass beide allmählich verstehen, was den anderen umtreibt, versuche ich, das Gespräch wieder mehr über die beiden laufen zu lassen“, sagt Knauer-Walter. Wenn beide „innerlich ausgesöhnt sind“, können sie beginnen, Ideen zu sammeln, wie sie in Zukunft weniger streiten. „Die kleinen, vorher so wichtigen Details verlieren an Gewicht“ und die Zahnpastatube ist nur noch ein Grund zu lachen. „Wenn die Streitenden es schaffen, das erste Bild, das sie vom anderen haben, zur Seite zu stellen und sich ganz dafür zu öffnen, was ihn umtreibt, dann spüre ich ein bisschen Frieden“, sagt Knauer-Walter.
Mediation kann Beziehungen nicht immer retten. Trotzdem hat Knauer-Walter erfahren, dass Paare, die sich scheiden lassen, ohne vorher über ihre Gefühle zu sprechen, verletzter auseinandergehen als Paare, die eine Mediation ausprobiert haben. Knauer-Walters Anspruch ist, dass beide am Ende das Gefühl haben, „sie haben sich fair behandelt und können sich umarmen oder die Hand geben, egal ob für einen Neuanfang oder zum Abschied“.
Luzia Arlinghaus
Bevor ein Streit eskaliert, kann es helfen, die Konflikthotline des Bundesverbands Mediation anzurufen. Ausgebildete Mediatorinnen und Mediatoren sind dort täglich, auch an Feiertagen, von 8 bis 20 Uhr kostenlos zu erreichen unter: 0800 247 36 76
Frieden im Krieg
„Ohne Frieden werden wir ein Leben voller Gewalt haben“
Der Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas stellt auch die Bewohnerinnen und Bewohner der Oase des Friedens vor eine Herausforderung. In dem kleinen Ort auf halber Strecke zwischen Jerusalem und Tel Aviv wohnen etwa 300 Menschen; auf Arabisch heißt er Wahat al-Salam, auf Hebräisch Neve Schalom.

Seit dem Beginn des Krieges haben alle Angst, jüdische, palästinensische und christliche Bewohner. Jede und jeder kennt Opfer des Krieges. Die Spannungen zwischen ihnen haben zugenommen, doch Gewalt lehnen sie ab. Das Dorf wurde 1970 als Friedensprojekt gegründet. Seitdem sind jüdische, palästinensische und christliche Bewohnerinnen und Bewohner in das Dorf gezogen, um bewusst als Gemeinschaft zu leben. Schon darin unterscheidet sich das Dorf von vielen anderen Orten in Israel, die „entweder jüdisch oder palästinensisch“ sind, sagt Roi Silberberg.
Er wohnt selbst in dem Dorf und leitet die Schule für Frieden, das wichtigste Projekt der Gemeinde. Die Schule bietet Kurse für jüdische und palästinensische Menschen im ganzen Land an. Immer geht es darum, dass die unterschiedlichen Gruppen miteinander in Kontakt kommen, über die gesellschaftlichen Konflikte sprechen und friedliche Lösungen entwickeln. Es gibt auch Kurse für Berufsgruppen wie Rechtsanwälte oder Architekten, die sich damit beschäftigen, wie man gleiches Recht für alle Menschen wirklich umsetzt oder wie man Siedlungen so baut, dass keine Gruppe bevorzugt oder verdrängt wird.
„Es ist unsere Verantwortung, es zu versuchen“
Doch in den vergangenen Wochen musste die Schule für Frieden zunächst die Bewohnerinnen und Bewohner des Dorfes selbst
unterstützen. Seit dem Krieg wächst nicht nur die Angst um die Freunde und Angehörigen. Es wachsen auch Probleme. Denn auch die Menschen in der Oase des Friedens seien Teil ihrer jüdischen oder palästinensischen Gemeinschaften, obwohl sie gemeinsam leben, erklärt Silberberg: „Sie bewerten die Dinge nicht in gleicher Weise und haben Probleme, einander zu vertrauen.“ Sechs Dialogseminare für das Dorf hätten den Menschen viel geholfen, ihre Gefühle wahrzunehmen und auch die Situation der jeweils anderen Gruppe zu verstehen. Die Beziehungen hätten sich dadurch verbessert.
Ob sie in dieser Situation noch an das Zusammenleben von Israelis und Palästinensern glauben können? „Es ist unsere Verantwortung, es zu versuchen“, sagt Silberberg. Die einen seien mehr, die anderen weniger optimistisch. Doch für ihn gibt es keine Alternative zum Dialog. Der Krieg habe den Glauben an den Frieden eher gestärkt. „Wir wissen, dass wir ohne Frieden ein Leben voller Gewalt haben werden“, sagt er. So sei es nicht nur der Glaube an den Frieden, der sie motiviert, sondern der Gedanke, dass es ohne ihn nicht möglich sein wird zu leben.
Barbara Dreiling
Frieden in der Forschung
„Der Dialog der Religionen ist ein entscheidender Punkt“
Heinz-Gerhard Justenhoven ist Optimist, oder besser: ein Mann des gläubigen Vertrauens. „Die Frage ist nicht, ob der Friede kommt“, sagt er. „Die Frage ist, ob wir uns dafür einsetzen.“ Und das sieht der Direktor des Instituts für Theologie und Frieden in Hamburg als geradezu weihnachtliche Aufgabe. „Die Botschaft der Engel vom Frieden auf Erden kommt historisch in eine Zeit enormer Unterdrückung, in der Rom als autoritärer Staat mit Dissidenten brutal umgeht. Es ist keine Botschaft für die warmen Stuben der Bürgerlichkeit, sondern eine für die Unterdrückten, für die, die unter Krieg leiden, für die, die am Rand stehen.“

Für Justenhoven ist Friede zwar eine politische Frage, aber im Hintergrund steht eine theologische Überzeugung. „Den Frieden, an den wir Christen glauben, hat uns Jesus Christus zugesagt. Er ist ein Geschenk, von dem wir glauben, dass es als Reich Gottes schon angebrochen ist.“ Worauf sich aber niemand ausruhen kann. „Angebrochen, nicht vollendet“, sagt Justenhoven. „Deshalb muss die Zusage des Friedens Auswirkungen haben im praktischen Leben. Wir Christen müssen uns fragen: Was können wir beitragen zu einem friedlichen Zusammenleben?“
Das gilt im Kleinen, aber auch im Großen. „In unseren Projekten erforschen wir vor allem, was auf gesellschaftlicher und politischer Ebene zum Frieden beitragen kann“, sagt Justenhoven. Solidarität, Liebe, Gerechtigkeit sind da Stichworte. Was die Nachfrage herausfordert: Interessiert das jemanden? „Das Interesse der Gesamtgesellschaft ist sekundär“, antwortet Justenhoven. „Die Frage ist, ob wir Christen uns dafür interessieren. Und uns dafür einsetzen. Erst dann, wenn wir den Frieden tun, wird er auch andere überzeugen.“
„Alle Religionen tragen den Wunsch nach Frieden in sich“
Die Forschungsprojekte im Institut beschäftigen sich auch damit, was Religionen zum Frieden beitragen können. „Der Dialog der Religionen ist ein entscheidender Punkt“, sagt Justenhoven. „Alle Religionen tragen den Wunsch nach Frieden in sich. Wir müssen gemeinsam daran arbeiten, dass die Menschen erkennen, wann und wie ihre Religion für den Hass instrumentalisiert wird.“ Dieses Anliegen teilten viele hochrangige Vertreter der Religionen, und oftmals gestalte sich das Zusammenleben der Menschen verschiedener Religionen ja auch friedlich. „Aber die guten Nachrichten, die positiven Beiträge sind eben seltener im Blick.“
Dass für den Frieden zu arbeiten „eine uferlose Aufgabe“ ist, ist Justenhoven klar. Aber: „Die Größe der Herausforderung ist kein Argument, gar nicht erst zu beginnen.“
Susanne Haverkamp