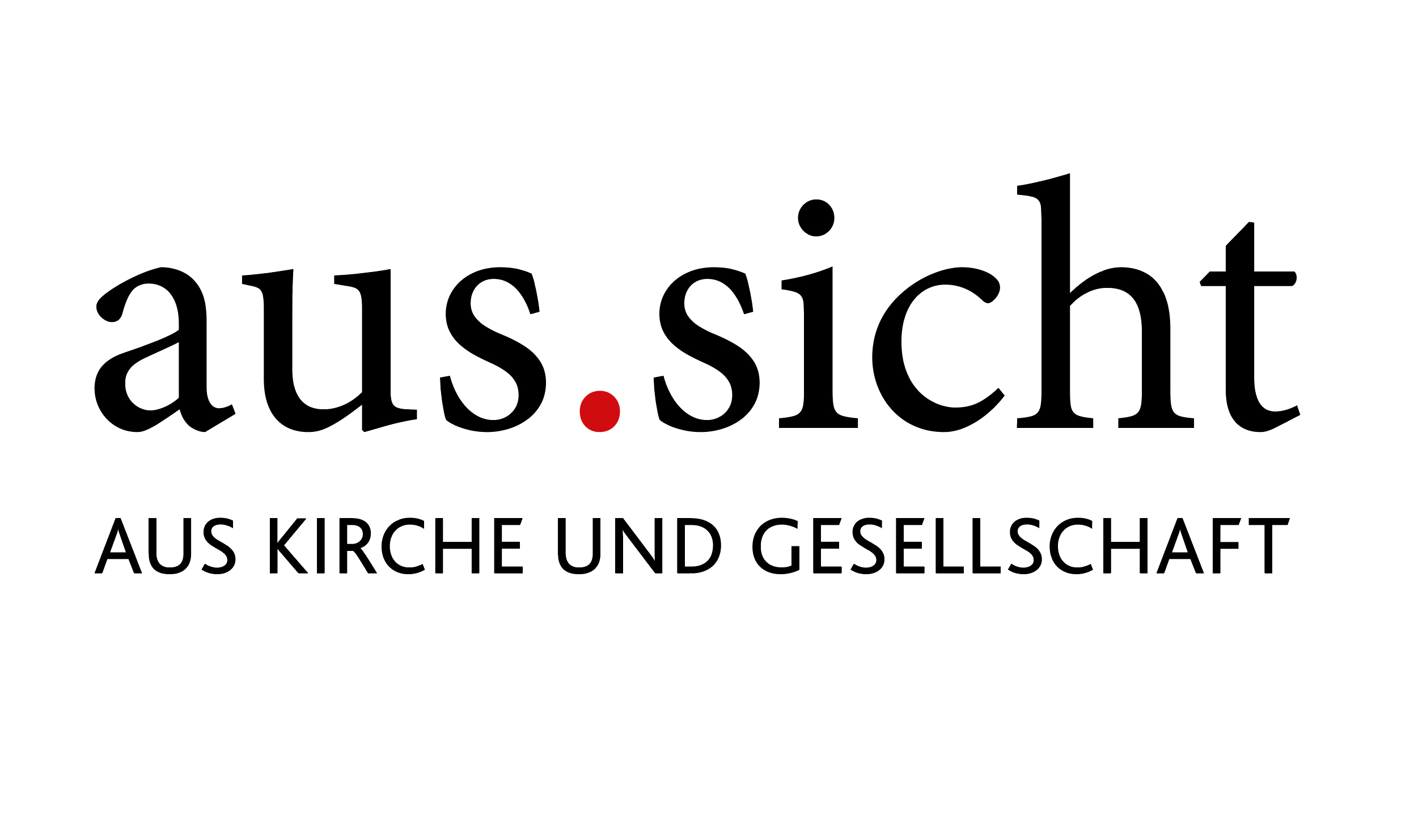Wider dem Glaubensverlust
„Ich möchte Urvertrauen vermitteln“
Abends, wenn es dunkel wird, zündet Dominic Gilbert mit Marie und Carlotta die Kerzen bei der Lourdes-Madonna im Garten an. Es ist Vater-Töchter-Zeit: Gelegenheit, darüber zu reden, was sie beschäftigt und Gott und der Gottesmutter ihren Dank und ihre Bitten darzubringen. Mit Mutter Helena kuscheln sich die neun und zwölf Jahre alten Mädchen gerne auf dem Sofa zusammen, lesen gemeinsam Bücher und reden wörtlich über Gott und die Welt.
Der sonntägliche Gottesdienstbesuch, das gemeinsame Beten und eine alljährliche Fahrt nach Taizé gehören zum Familienleben der Gilberts ganz selbstverständlich dazu. Der Weihnachtsmann war nie Thema, auch wenn es Geschenke gibt. Immer war klar: An Weihnachten feiern sie die Geburt Christi.
Nach dem aktuellen Religionsmonitor der Bertelsmann-Stiftung gab nur jede vierte Person in Deutschland im Alter von 16 bis 24 Jahre an, religiös erzogen worden zu sein. Unter den Mitgliedern der römisch-katholischen Kirche scheint die Weitergabe des Glaubens in der Familie weiterhin wichtig zu sein: In der Befragung erklärten 92 Prozent aller befragten Katholiken, religiös erzogen worden zu sein.
„Ich denke, durch die religiöse Erziehung erleben die Kinder mehr Sinnhaftigkeit. Es gibt im Leben eine größere Dimension. Ich möchte den Kindern auch gerne ein gewisses Urvertrauen vermitteln, dass jemand sie im Leben begleitet, dass sie Vergebung und Versöhnung erfahren. Sie müssen die Herausforderungen des Lebens nicht alleine meistern“, sagt Helena Gilbert, die als Gemeindereferentin in einer Pfarrei in Mainz arbeitet.
Kinder sollen einen Blick für den Nächsten entwickeln
Die Eltern möchten ihren Kindern ein Vorbild sein und ihnen vermitteln, einen Blick für den Nächsten zu haben. Sie nehmen sich Zeit, wenn sie Obdachlose antreffen. Die Eltern sind überzeugt: „Die Kinder profitieren auf jeden Fall von religiöser Erziehung, egal welche Glaubensrichtung es ist.“
In den Küchenschränken von Familie Quensel aus Frankfurt gibt es zwei Sorten Pfannen und Töpfe. Denn die jüdischen Speisegesetze sehen vor, dass Milch und Fleisch nicht im selben Kochgeschirr zubereitet werden dürfen. Auch sonst ist das Judentum im Alltag sehr präsent bei den Quensels. Am Freitag-
abend gehen Anastasia Quensel, ihr Mann und ihre beiden 14 und 17 Jahre alten Kinder in die Synagoge.
Sie selbst stammt aus Sankt Petersburg und kam mit ihren Eltern nach der Wende nach Aachen. Später zog sie nach Frankfurt, wo sie in der jüdischen Gemeinde ihren Mann kennenlernte. Sie habe selbst erst als junge Erwachsene ihre Religion so richtig für sich entdeckt, sagt die 39-Jährige.
Wenn die Familie am Freitagabend aus der Synagoge kommt, sind die Mahlzeiten für die Zeit bis Samstagabend vorbereitet. Alle elektrischen Geräte haben die Quensels über Zeitschaltuhren programmiert. Denn bis am Samstag die Sonne untergegangen ist, dürfen sie nicht betätigt werden. Auch Handys und Computer sind tabu. Samstags geht die Familie zum Gebet wieder in die Synagoge, „danach sitzen wir dort oft noch bis nachmittags mit anderen Familien zusammen“, sagt Anastasia Quensel.
Ihren Glauben vorzuleben, sieht sie weniger als Notwendigkeit denn als Selbstverständlichkeit. „Wie soll ich meinen Glauben nicht vermitteln, wenn ich ihn doch lebe?“, fragt sie. Dabei möchte sie ihrem Sohn und ihrer Tochter nichts aufzwingen. Doch manche Regeln sind ihr wichtig. So könnte sie es zwar nicht akzeptieren, wenn die Kinder ein Schweineschnitzel essen wollten: „Aber wenn sie mal keine Lust haben, die Synagoge zu besuchen, dann ist das okay.“ Wichtig findet Quensel, dass die Gemeinde ihren Kindern die Möglichkeit gibt, sich sozial zu engagieren.
Auch der Alltag von Familie Noureddine ist von religiösen Riten geprägt. Iman Noureddine ist schiitische Muslimin und lebt mit ihren beiden Söhnen, 12 und 13 Jahre alt, und ihrer achtjährigen Tochter in einer Kleinstadt in der Pfalz. Morgens treffen sich Iman Noureddine und ihre Kinder zum gemeinsamen Gebet. Ihre Söhne seien gerade in einer Phase, wo sie nicht immer Lust dazu hätten, sagt Iman Noureddine. Die kleine Tochter, die samstags auch eine arabische Schule besucht, habe aber viel Freude daran.
Die Eltern der 33-Jährigen stammen aus dem Libanon, sie selbst ist in Niedersachsen geboren. Als Kind hatte sie nur wenige deutsche Freundinnen, sie durfte nicht zu Klassenfahrten oder andere Kinder besuchen.
In der Erziehung ihrer Kinder macht sie das anders: „Religion ist wichtig, aber Offenheit mindestens genauso.“ Das bedeutet für sie, als gläubige Muslimin Teil der deutschen Gesellschaft zu sein und ihren Kindern zu zeigen, wie das gehen kann: „Vorbild sein, heißt für mich, die Dinge nicht vorzusagen, sondern vorzuleben.“ Noureddine war Elternsprecherin an der Schule ihrer Kinder, sie hilft dort beim Backen der Weihnachtsplätzchen und besucht die Fußballspiele ihrer Söhne. Sie freut sich, wenn ihre Kinder die täglichen Gebete mitsprechen, zwingt sie aber nicht dazu. Wenn sie zur Schule gehen, ruft sie ihnen „Salam aleikum“ (dt.: Friede mit dir) hinterher.
Kopftuch tragen? „Es ist allein ihre Entscheidung“
Das Kopftuch war ein Thema, bei dem ihre eigenen Eltern tolerant waren. Mit zwölf Jahren wollte Iman Noureddine es tragen, mit 14 fühlte sie sich nicht mehr wohl damit. Der Vater erlaubte ihr ohne Vorwurf, es auszuziehen. Mit 17 zog sie es wieder an und behielt es bei. Heute sagt sie: „Es gehört zu mir.“ Sie möchte, dass ihre Tochter sich einmal selbst aussucht, ob sie ein Kopftuch tragen will. „Natürlich würde ich mich darüber freuen. Aber es ist allein ihre Entscheidung.“ Am wichtigsten ist ihr, dass ihre Kinder „von dem, was sie tun, überzeugt sind und ehrlich durchs Leben gehen“.