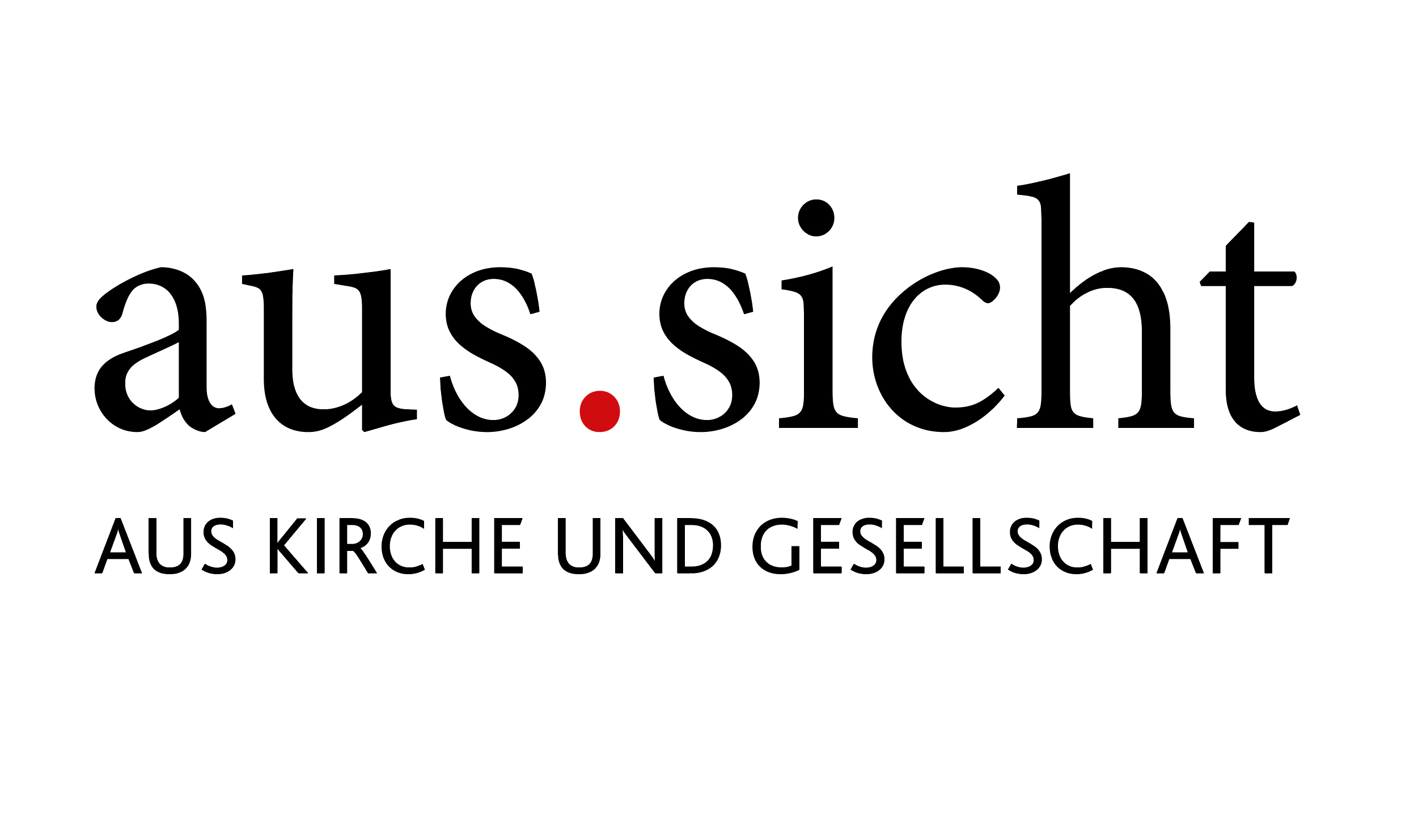Weihbischof Volodymyr Hruza aus Lwiw über Hoffnung und Glauben im Krieg
„Wir spüren, Gott ist bei uns“

Foto: Pressestelle der Erzdiözese Lwiw
Ein Flüchtlingskind aus der Ukraine wird getauft. Pate ist ein Student der Militärakademie.
Anfang Juli kam der Krieg ganz nah. Die Russen beschossen ein Wohngebiet in der westukrainischen Stadt Lwiw mit Raketen. Das mörderische Ergebnis: zehn Tote, 42 Verletzte und etliche zerstörte Häuser, darunter ein Waisenhaus. Volodymyr Hruza, der griechisch-katholische Weihbischof der Erzdiözese Lwiw, erzählt, die Raketen seien 500 Meter von ihm entfernt explodiert.
Wer mit Hruza spricht, der versteht, welch ein Horror Wladimir Putins Angriffskrieg für die ganze Ukraine ist – auch für jene Regionen, die nicht in der Nähe der Front liegen. Immer wieder zwingt der Luftalarm die Menschen in die Bunker. Wenn die Sirenen tags heulen, unterbrechen die Schüler den Unterricht, die Geschäfte schließen, die Industrie stoppt ihre Produktion. Wenn sie nachts heulen, reißen sie die Menschen aus dem Schlaf. Manchmal für Stunden.
Die russischen Angriffe auf zivile Ziele seien „eine Methode, um die Menschen zu erschöpfen“, sagt Hruza. „Anspannung und Angst sind immer da.“ Die Menschen seien sensibel für jedes Geräusch. Kürzlich habe es gewittert, da hätten viele gebangt: „Ist das jetzt ein Donner oder eine Bombe?“ Fast aus jeder Familie kämpft jemand an der Front. Tag für Tag fürchten die Angehörigen, er könnte gefallen sein. Wenn sie mal keine Verbindung zu ihm haben, umso mehr.
Der Weihbischof glaubt, es sei wichtig, zu der Angst zu stehen. Aber auch: Hoffnung zu schöpfen – so schwer das ist, wenn sein Land von einem Diktator mit imperialistischen Wahnvorstellungen angegriffen wird. Hruza spürt die Hoffnung, wenn viele junge Menschen zu den Begräbnissen der Soldaten kommen: vereint im Schmerz, dankbar für den Dienst der Gefallenen und froh, dass ihr Leben weitergeht, trotz allem.
Hoffnung, sagt Hruza, gebe auch das kirchliche Leben: die Gottesdienste; das Evangelium, das sie mit ihren kriegsgeplagten Augen lesen; die Geschichten von Heiligen und Märtyrern, die auch in schweren Zeiten gelebt haben; die Kommunion, in der die Gläubigen mit Gott vereint sind. „Ich weiß nicht, was passiert, heute und morgen, ob ich lebe oder sterbe“, sagt Hruza. Aber er glaubt daran, dass nach dem Tod das ewige Leben kommt. „Und ich sage: Gut, wenn der heutige Tag der letzte ist, dann versuchen wir ihn in Würde zu begehen.“
„Unser größter Traum wäre, nachts ruhig zu schlafen“
Hruza will den Menschen ein Stück Normalität schenken. Er tauft Kinder, traut Ehepaare, weiht Priester. Er bewundert den Durchhaltewillen der Ukrainer, die schon so viele Opfer gebracht haben: „Sie sind bereit, bis zum Letzten zu gehen.“ Er sieht aber auch, dass „wir alle traumatisiert sind, ganz klar“. Seine Erzdiözese schult jetzt die Priester, damit sie wissen, wie sie mit diesen Menschen umgehen können. Mit Soldaten, denen der Wahnsinn des Krieges im Kopf herumspukt. Oder mit ihren Frauen, die fürchten, dass ihre Ehe daran zerbricht.
Natürlich, sagt Hruza, könnten die Ukrainer verzweifeln. Aber das tun sie nicht: „Wir spüren, Gott ist bei uns. Er hat uns nicht verlassen.“ Der Glaube gibt ihnen sogar die Kraft zu träumen. Hruza sagt: „Unser größter Traum wäre, nachts ruhig zu schlafen. Und: einen gerechten Frieden zu bekommen. Wir wollen einfach würdig hier leben.“