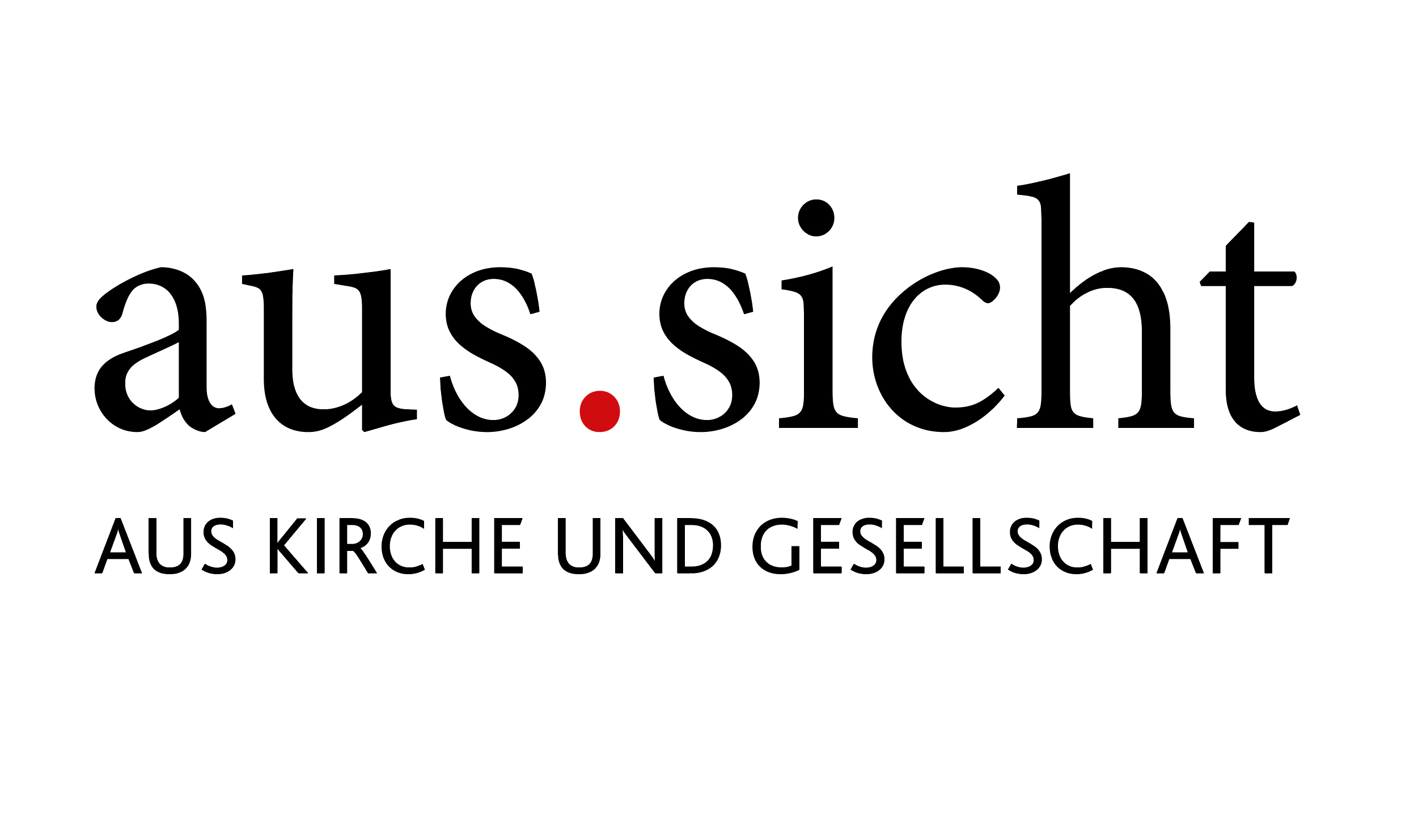Fastenzeit im Kloster
Befreiendes Gefühl

Foto: Kloster Esterwegen
Schwester Birgitte Herrmann vom Kloster Esterwegen. Dort, wo eine Gedenkstätte an das ehemalige Konzentrationslager erinnert, hat das Bistum Osnabrück seit 2007 ein kleines geistliches Zentrum eingerichtet.
Schwester Birgitte, was bedeutet Ihnen die Fastenzeit?
Früher als Jugendliche war ich nicht scharf auf die Fastenzeit und habe nur gedacht: Oh Gott, jetzt muss ich wieder wochenlang auf alles Mögliche verzichten. Das sehe ich heute anders. Man muss sich nicht alles, was Freude macht und gut schmeckt, verkneifen. Vielmehr regt die Fastenzeit dazu an, sich neu auszurichten, sich zu fragen, ob man die frohe Botschaft noch im Blick hat oder ob vielleicht etwas auf der Strecke geblieben ist.
Die Fastenzeit als eine Art Gewissenserforschung?
Ja. Das Aschenkreuz erinnert daran, dass wir vergänglich sind. Deshalb überlege ich immer wieder aufs Neue, worauf es ankommt im Leben. Ähnlich geht es vermutlich auch anderen Menschen, denn ich stelle fest, dass in der Fastenzeit mehr Gruppen als sonst die Gedenkstätte Esterwegen besuchen und sich einem Ort nähern, der eine menschenverachtende Geschichte hat, wo Häftlinge gelitten haben. Einige Besucher kommen auch ins Kloster nebenan, wo es Gedenkräume mit vielen Symbolen gibt. Dort können sie Kerzen entzünden und das Erlebte reflektieren. Wir Ordensfrauen sind einfach da und hören zu, wenn jemand etwas auf dem Herzen hat.
Wie gestalten Sie die Fastenzeit im Kloster?
Wir werden wieder Exerzitien im Alltag anbieten, zu denen man sich anmelden kann. In großen Ordenskonventen ist es oft üblich, während der Fastenzeit zum Beispiel kein Fleisch einzukaufen und das Geld für einen guten Zweck zu spenden. Das lohnt sich für uns drei Schwestern nicht. Wir sind sowieso relativ anspruchslos, was das Essen betrifft – was aber nicht heißt nicht, dass wir nicht genießen können. Wir nutzen die Fastenzeit, um uns als Konvent neu auszurichten: Wie gehen wir miteinander um? Können wir aufmerksamer sein? Das tut unserem Zusammenleben gut.
Worauf verzichten Sie als Ordensfrau auch sonst im normalen Alltag?
Ich habe nicht das Gefühl, auf etwas verzichten zu müssen. Meine Mitschwestern und ich haben alles, was wir fürs Leben brauchen: Verpflegung, Ordens- und Zivilkleidung, Geld, über das wir verfügen können. Sollte etwas knapp werden, unterstützt uns das Mutterhaus. Das ist eine Sicherheit, die Menschen, die auf vieles verzichten müssen, weil alles teurer wird, nicht haben.
Das klingt nach Zufriedenheit.
Ich habe mich ja persönlich für Einfachheit entschieden. Verboten wird uns im Kloster übrigens nichts, wir dürfen zum Beispiel auch Alkohol trinken oder mal ins Kino gehen. Viele denken, dass ein Ordensleben in Armut und Ehelosigkeit nur einschränkt. Aber: Weniger zu besitzen, gibt uns auch Freiheit. Wie gut sich das anfühlen kann, wird jeder bestätigen, der zu Hause den Kleiderschrank ausmistet oder es schafft, sechs Wochen lang keine Süßigkeiten zu essen. Ehelosigkeit bedeutet nicht, dass ich gegen Familie bin, im Gegenteil. Diese Kontakte, auch zu Freunden, pflege ich. Aber ich bin frei, ungebunden und bereit, überall dort hinzugehen, wo ich gebraucht werde.
Verzicht kann also auch zum Gewinn werden?
Es ist ein befreiendes Gefühl, wenn ich merke, dass ich Dinge lassen kann, die mir nicht guttun. Oder dass ich genießen kann. Wenn ich jeden Tag Torte esse, ist es nichts Besonderes mehr. In unserem Konvent gibt es wochentags keinen Nachtisch – nicht, weil wir ihn nicht wollen. Dafür freue ich mich umso mehr auf den Sonntagsnachtisch. Oft höre ich: „Das ist doch ein must have!“ Also etwas, das man unbedingt haben muss, auf das man für ein gutes Leben nicht verzichten kann. Ich möchte mir das nicht vorschreiben lassen.