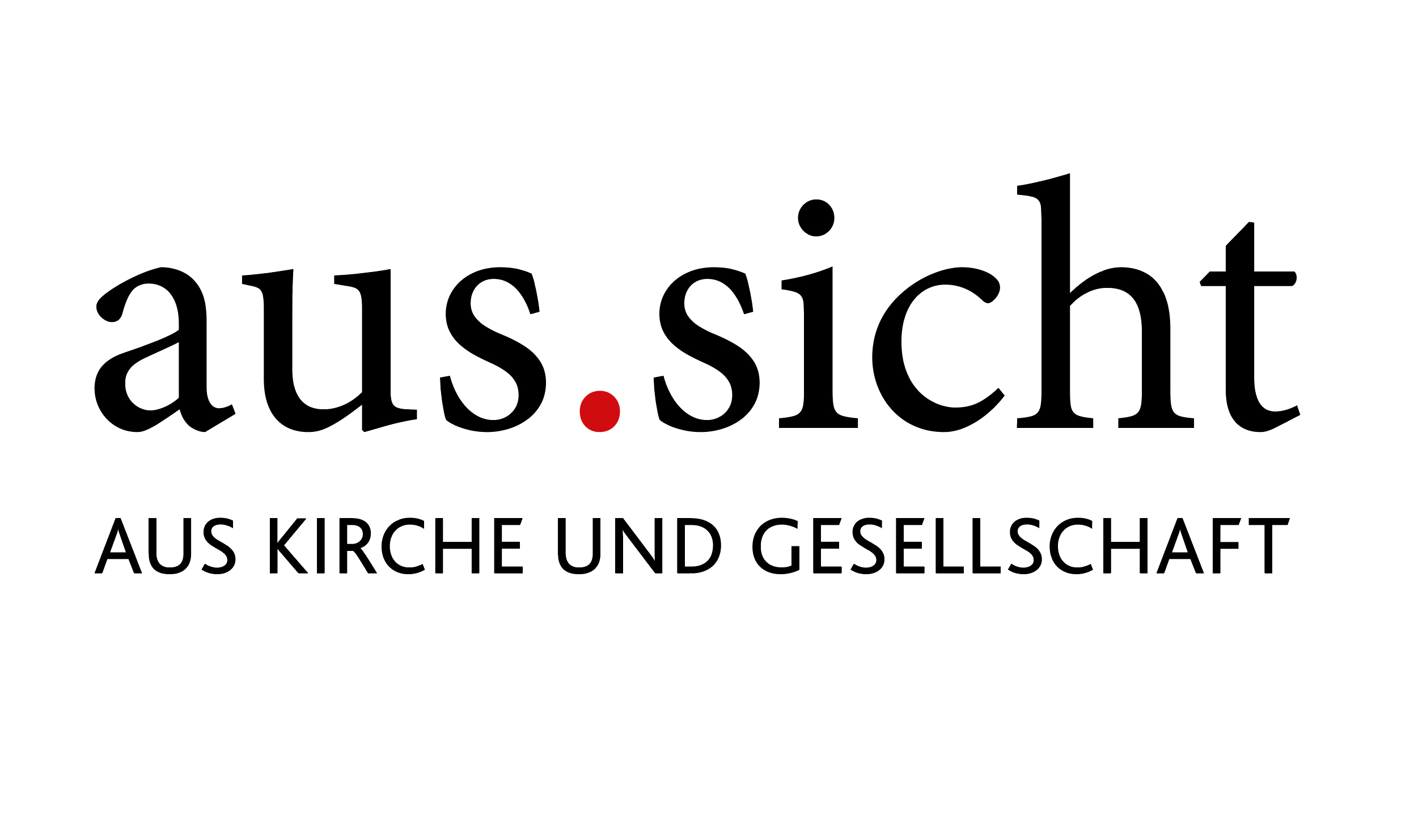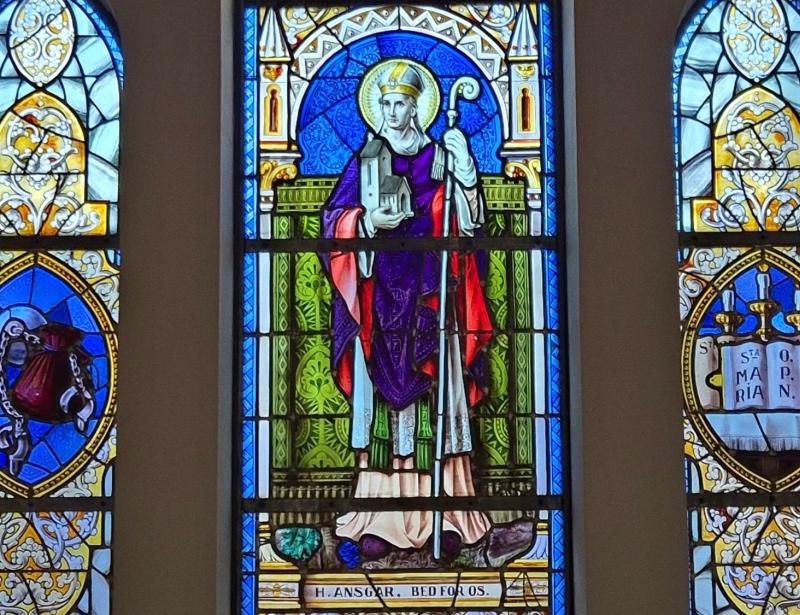Woche für das Leben: Menschen mit Behinderung
„Ey, ich bin nicht irre!“

Foto: Stephanie Jegliczka
Gute Erinnerung: In dem Tagebuch schreiben die Mitarbeiter der Einrichtung für Anton auf, was er erlebt und wie er sich gefühlt hat.
Die Türen des weißen Bullis öffnen sich und schon hört man Anton Hein lachen und rufen. Er hat Feierabend, seine Arbeit in der Werkstatt ist für heute getan. Eine Betreuerin holt den jungen Mann in seinem Rollstuhl aus dem Transporter. Fröhlich winkt er seinen Eltern zu, die auf dem Hof des St.-Maria-Elisabeth-Hauses auf ihn warten. „Ja, damit hast du nicht gerechnet, dass wir heute hier sind, oder?“, fragt seine Mutter Ellen Hein und nimmt ihn in den Arm. Sein Vater Georg streicht ihm über den Kopf. „Sonst hättest du den ganzen Morgen in der Werkstatt nur Rabatz gemacht, weil du nicht warten kannst“, sagt er. Anton lacht und schlägt vor Freude seine linke Hand an die Lehne des Rollstuhls. Gemeinsam gehen sie in Antons Zimmer.
Der 24-Jährige ist mehrfach schwerstbehindert. Seit gut einem Jahr lebt er in der Einrichtung für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung in Bad Laer, südlich von Osnabrück. Zuvor hat er bereits mehrere Jahre in einer anderen Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderung gelebt. Junge Menschen wie Anton stehen in diesem Jahr im Mittelpunkt der „Woche für das Leben“. Die ökumenische Aktion der beiden christlichen Kirchen in Deutschland fragt: Wie steht es um die Inklusion in Deutschland? Wie sehr können Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben teilnehmen? Und wo gibt es Hürden – gerade für junge Erwachsene mit Behinderung?

Anton hat es sich in seinem Zimmer im St.-Maria-Elisabeth-Haus gemütlich gemacht. In den Regalen liegen Spiele und Kinderbücher. In der Zimmerecke steht eine riesige Benjamin-Blümchen-Plüschfigur, an der Wand hängen ein Fernseher und farbenfrohe Bilder. Anton sitzt in seinem Sessel, sein Vater an seiner Seite auf der Lehne. Auf Antons Schoß liegt ein Steckpuzzle. Er versucht, die verschiedenen Figuren in die richtigen Lücken zu setzen. „Anton, das passt noch nicht“, sagt Vater Georg und hilft seinem Sohn. Anton dreht die Figur und versucht es erneut. Die Giraffe rutscht in die passende Form.
Erwachsen zu werden, heißt für Anton, viele kleine Schritte zu gehen. Ein selbstständiges Leben, so wie es Gleichaltrige ohne Behinderung führen, mit Studium, Berufsstart, Club-Besuchen und Urlaubsreisen mit Freunden wird er nicht haben. Grund dafür ist ein Unfall: Mit gut zwei Jahren, am Geburtstag seines älteren Bruders Julius, ist Anton von einer Rutsche gestürzt. „Wir waren bei zwei Ärzten. Aber niemand hat etwas festgestellt. Sie sagten, es sei alles in Ordnung“, sagt Mutter Ellen. „Drei Tage später kippte er auf einmal um.“ Die Eltern fuhren mit ihrem Sohn in die Klinik, bei der Untersuchung wurde ein großes Hämatom im Gehirn festgestellt. Anton wurde sofort notoperiert, doch die Schäden, die durch die Blutung entstanden waren, waren zu groß: Anton war gelähmt, er hatte Krampfanfälle und Spastiken. Er brauchte nun ständige Betreuung und Pflege.
Fragt man ihn heute, was er alleine machen kann, sagt er ganz unverblümt: „A-a.“ Seine Eltern lachen. „Ja, das können wir alle. Aber du kannst noch mehr“, sagt seine Mutter. Wenn die Mahlzeiten vorbereitet sind, isst und trinkt er allein. Mit dem Rollstuhl oder seinem Walker, einer Art Gehhilfe, bewegt er sich in der Wohngruppe. „Seine Haltung hat sich verbessert, er kann den linken Arm besser kontrollieren, die Krampfanfälle sind weg“, sagt Ellen.
Täglich arbeitet Anton im Nachbarort in einer Werkstatt. „Malochen. Schrauben sortieren“, sagt Anton dazu. In seiner Freizeit spielt er am liebsten auf dem Tablet oder schaut sich Filme auf YouTube an. Und er liebt es, laut Musik zu hören. „Da ist alles dabei: Kinderlieder, Ballermann-Hits, Howard Carpendale, AC/DC“, sagt Ellen. „Thunder“, wirft Anton ein. „Ja, dein Lieblingslied. Und da ist er richtig textsicher. Da hat er eine gute Auffassungsgabe – so irre er auch sonst ist“, sagt die Mutter mit einem Lachen. „Ey, ich bin nicht irre“, erwidert Anton.

Zum Erwachsensein gehört auch, selbstständig zu leben, eine eigene Wohnung zu haben und für sie verantwortlich zu sein. Für Anton ist das mit Einschränkungen möglich. Im Alter von 14 Jahren ist er aus seinem Elternhaus in ein Wohnheim in Osnabrück gezogen. „Ich habe die Pflege zu Hause nicht mehr geschafft. Anton wurde einfach zu schwer. Außerdem schlief er keine Nacht durch“, sagt Mutter Ellen.
Für die Eltern war das kein leichter Schritt. „Wir haben zwei Jahre gebraucht, um überhaupt diese Entscheidung fällen zu können“, sagt Vater Georg. Die ersten Monate waren besonders schlimm. „Wenn Sie ein Kind so lange und so eng bei sich haben und dann ist es auf einmal weg, tut das weh“, sagt Ellen Hein. In der Nacht glaubte sie, sein Rufen und Klopfen zu hören. „Ich konnte mich an die Stille nur schwer gewöhnen.“ Und zugleich habe sie ein Gefühl von Freiheit gehabt, das sie schon fast vergessen hatte. „Diese Mischung von Gefühlen kann man nicht beschreiben. Es war wirklich eine schwierige Zeit“, sagt Ellen Hein.
Aber die Eltern spürten bald, dass Anton der Auszug guttat. In der Einrichtung lebten viele, die er aus seiner Schule kannte. Er fand schnell Anschluss. Und er wurde selbstständiger. Er lernte, kleine Dinge aufzuräumen, den Tisch bei den Mahlzeiten sauber zu halten und seine Gefühle besser zu kontrollieren. „Wenn er bei uns zu Hause etwas wollte und wir es ihm nicht gegeben haben, dann hat er mit Dingen geworfen, Sachen kaputt gemacht. Du musstest machen, was er wollte, sonst hattest du keine Chance“, sagt Ellen Hein. „Er hat sofort gewusst, wie er uns kriegt.“
Das sei heute besser. Die Mitarbeiter in den Einrichtungen schafften es, Anton Grenzen zu setzen. „Er ist ordentlicher geworden und reifer“, sagt seine Mutter. Auch die Beziehung der Eltern zu ihrem Sohn hat sich entwickelt. „Ich freue mich heute viel mehr, ihn zu sehen und ihn bei mir zu haben, als wenn ich mich die ganze Nacht um ihn kümmern muss und den Stress der dauernden Fürsorge aushalten muss“, sagt Mutter Ellen. Und Anton freut sich riesig, wenn er für ein Wochenende zu den Eltern kommt. „Dann machen wir alles, was er sich wünscht“, sagt Ellen: „Ausflüge, Musikhören, Grillen oder zu McDonalds fahren. Das ist immer ein Highlight für ihn.“ Manchmal schenken sie ihm beim gemeinsamen Abendessen ein bisschen Bier mit Wasser in ein Schnapsglas ein. Ein kleines bisschen Normalität – und ein kleines bisschen Erwachsensein.
Auch Paul Niederdalhoff, der Leiter des St.-Maria-Elisabeth-Hauses, sieht eine klare Entwicklung bei Anton: „Er ist schon sehr selbstbestimmt. Er weiß, was er will und sagt das auch.“ Er zeige, wenn ihn etwas nervt, welche Mitarbeiterin er mag und welche nicht. „Manchmal klopft er an meine Bürotür und besucht mich. Mit dem Walker ist er recht mobil und kann selbst entscheiden, wohin er möchte“, sagt Niederdalhoff.
Erwachsene ohne Behinderung denken über die Frage, ob so etwas geht, kaum nach. Für Menschen mit einer kognitiven oder mehrfachen Behinderung sind das aber Meilensteine: selbst zu entscheiden, was sie essen oder wohin sie gehen möchten – und zu merken, kein anderer setzt sich über ihren Willen und ihre Wünsche hinweg.
Doch immer noch hat Antons Selbstbestimmung Grenzen. Zum Beispiel bei Arztbesuchen. „Für uns Normalos ist ganz klar, dass wir in eine Praxis gehen und dort behandelt werden. Bei uns kommen Zahnarzt, Hausarzt und Neurologe in die Einrichtung“, sagt Niederdalhoff. Würde Anton zu einem Zahnarzt in den Ort gehen, müsste der Einrichtungsleiter dafür zwei Mitarbeiter abstellen und ein Rollstuhltaxi organisieren. „Die Ressourcen werden uns vom Leistungsträger nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung gestellt. Da ist Effizienz nötig – auf Kosten von Inklusion“, sagt er.
Antons Eltern freuen sich erst mal darüber, was alles gut ist. „Kleine Kinder, kleine Sorgen – große Kinder, große Sorgen: Das Sprichwort trifft auf uns nicht zu“, sagt Vater Georg. „Früher war es wesentlich schwieriger für uns und Anton.“ So lange sie können, werden sie sich um ihren Sohn kümmern. Wenn sie das nicht mehr schaffen, wird Antons drei Jahre älterer Bruder, der sich gut mit seinem kleinen Bruder versteht, die Fürsorge übernehmen. „Ich habe da keine Angst“, sagt Mutter Ellen. „Anton ist hier in Bad Laer gut angekommen. Gesundheitlich geht es ihm soweit gut. Und das Wichtigste ist doch, dass er sich wohlfühlt und zufrieden ist.“
„Die Kirchen sind Ermöglicher“
Junge Erwachsene wollen selbstbestimmt leben, auch wenn sie schwerbehindert sind. Caritas-Referentin Stefanie von Frieling weiß um ihre Wünsche und um Probleme bei Wohnungs-, Arbeits- oder Partnersuche.
Wie gut sind junge Menschen mit Behinderung in Deutschland integriert?
Menschen mit Behinderung treffen trotz Behindertenrechtskonvention auf viele Barrieren. Die Vereinten Nationen kritisieren aktuell, der Weg in Sonderwelten beginne in Deutschland früh, oft schon im Kindergarten. Mehr als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen besuchen nach der Sonder-Kita eine gesonderte Schulform, die die große Mehrheit ohne Abschluss verlässt. Einer Bertelsmann-Studie von 2023 nach waren das zuletzt 73 Prozent.
Was wünschen sich die jungen Menschen?
Ich möchte nicht für Menschen mit Behinderung sprechen, weiß aber aus vielen Gesprächen, dass sie oft ähnliche Sehnsüchte haben wie junge Erwachsene ohne Behinderung: ein zufriedenstellendes Berufsleben, eine eigene Wohnung, eine liebevolle Partnerschaft. Sie wollen keine Sonderwelt. In Deutschland tun wir uns damit aber häufig noch schwer.

Sie sagen, dass viele Menschen mit Behinderung sich eine Partnerschaft wünschen. Wie schwierig ist dieses Thema gesellschaftlich?
Da hat sich in den letzten Jahren viel bewegt, auch dank vieler Initiativen von Menschen mit Behinderung und ihren Angehörigen. Sie sorgen dafür, dass Liebe und Sexualität von Menschen mit Behinderung in der Öffentlichkeit thematisiert werden. Es wurden Kontaktbörsen geschaffen, es gibt Beratungsangebote und Wohnkonzepte für junge Erwachsene mit Behinderung, um als Paar gemeinsam zu leben.
Sie haben erwähnt, dass ein Teil dieses Erfolgs auf Initiativen von Angehörigen zurückgeht. Ist das Thema Sexualität für die Eltern nicht auch problematisch?
Ich habe oft erlebt, dass Eltern sich sorgen. Wenn von Menschen mit Behinderung und ihrem Recht auf sexuelle Selbstbestimmung die Rede ist, scheint Lust kaum noch ein Thema zu sein. Viel häufiger stehen die Folgen und Gefahren von Sexualität im Mittelpunkt, etwa sexuelle Gewalt. Bei aller Sorge dürfen einem jungen Menschen mit Behinderung – und sei sie noch so erheblich – die Grundrechte aber nicht verwehrt werden. Dazu zählt auch das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung.
Auf dem Weg ins Erwachsenenleben ist auch der Einstieg in einen Beruf ein wichtiger Meilenstein. Haben junge Menschen mit Behinderung realistische Chancen auf dem Arbeitsmarkt?
Die Chancen sind immer noch minimal, verglichen mit den Chancen, die Jugendliche ohne Behinderung haben. Viele Menschen mit Behinderung finden nie ihren Traumjob. Schulabgänger von sogenannten Förderschulen treten ihren Arbeitsweg in der Regel in Werkstätten für Menschen mit Behinderung an. Zu deren Auftrag gehört eigentlich die Qualifizierung für eine Beschäftigung auf dem regulären Arbeitsmarkt. Das gelingt allerdings selten.
Am Geld scheitern viele Formen der gesellschaftlichen Teilhabe.“
Was sollte die Politik tun, um junge Menschen mit Behinderung besser zu fördern?
Ein massives Problem ist nach wie vor die hohe Armutsquote unter Menschen mit Behinderung. Auch der fehlende Wohnraum steht einem selbstbestimmten Leben entgegen. Das betrifft ganz besonders junge Menschen, die dauerhaft Assistenz benötigen. Es fehlen Fachkräfte und Anbieter von Plätzen in sogenannten Besonderen Wohnformen. Das müsste noch mehr in den Fokus rücken, denn am Geld scheitern viele Formen der gesellschaftlichen Teilhabe.
Wie schwierig ist es für junge Menschen mit Behinderung, eine Wohnung zu finden?
Der Wohnungsmarkt ist katastrophal – erst recht, wenn man mit Problemen wie Armut oder einer schwerwiegenden Behinderung zu kämpfen hat. Der fehlende oder unbezahlbare Wohnraum steht einem selbstbestimmten Leben entgegen. Dazu kommt, dass laut Schätzungen von Experten nur zwei Prozent aller Wohnungen in Deutschland barrierefrei sind.
Finden Menschen mit Behinderung in speziellen Einrichtungen oder Wohngemeinschaften leichter einen Platz?
Auch das ist häufig schwierig. Neubauten oder Modernisierungen solcher Einrichtungen sind kaum noch zu finanzieren und die alten Einrichtungen entsprechen nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben. Ein Zimmer muss heute mindestens eine Größe von 14 Quadratmetern haben. Momentan haben wir aber häufig Zimmer mit einer Größe von 10 bis 12 Quadratmetern. Da hält die von allen gewünschte Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen, die der Gesetzgeber erreichen will, nicht mit den finanziellen Mitteln, die es dafür braucht, Schritt.
Welche Rollen spielen die Kirchen bei all diesen Fragen?
Die Kirchen sind häufig Ermöglicher: Sie haben viel auf den Weg gebracht, was Inklusion angeht. Die Caritas und die Diakonie finden in den Kirchengemeinden vor Ort gesellschaftliche Player, die offen sind für die Belange von Menschen mit Behinderung. Damit prägen die Kirchen auch das Bild der Eingliederungshilfe. Historisch haben sie immer wieder Verantwortung für Menschen übernommen, die auf gesellschaftliche Barrieren trafen – das sollten sie auch künftig beibehalten.