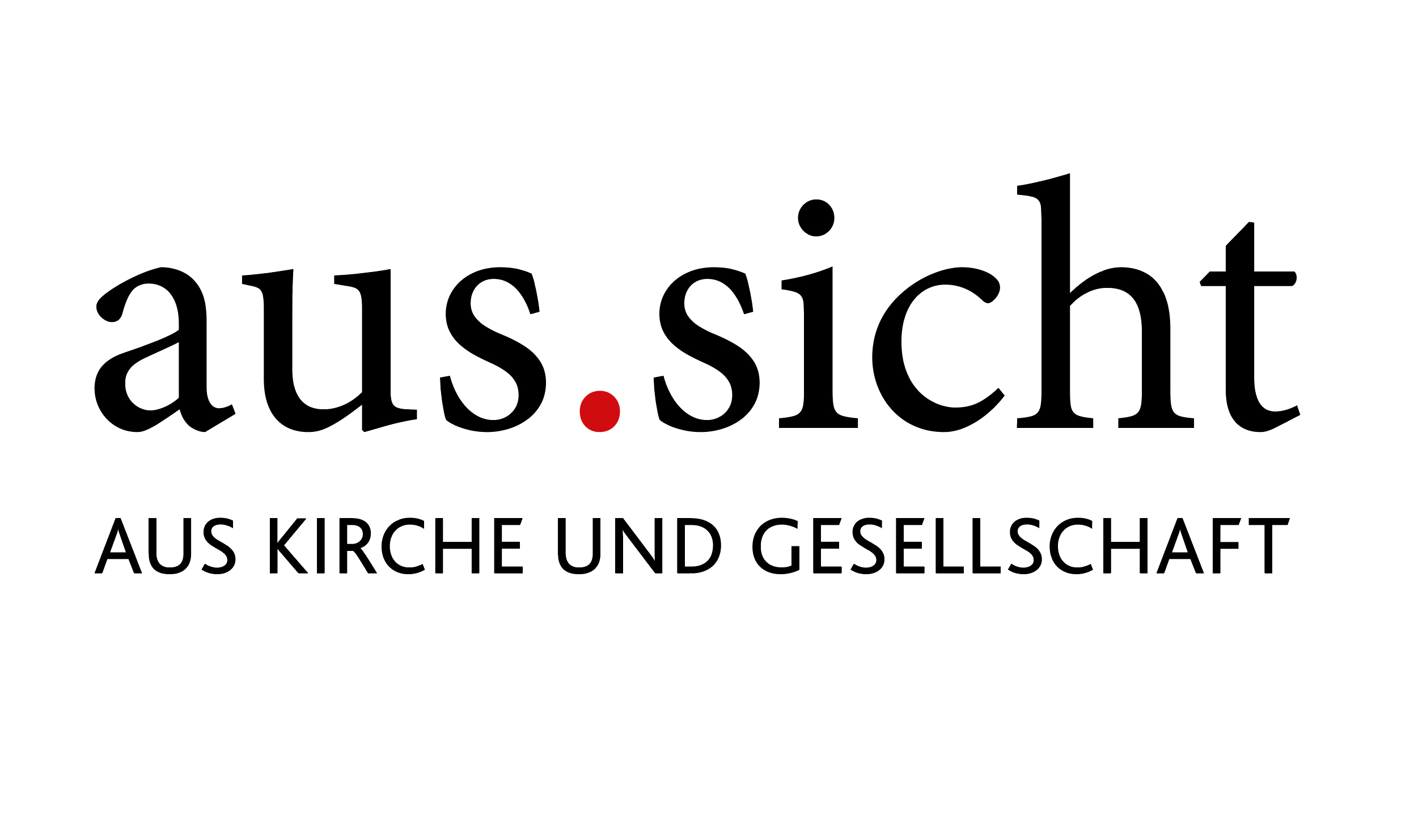Schwerpunkt: Ein Christ, ein Muslim und ein Jude sprechen über den Glauben
"Wir nähern uns demselben göttlichem Geheimnis"

Foto: Florian von Ploetz
Der Jesuit Felix Körner (links), der Muslim Mansur Doğan (Mitte) und der Jude Daniel Fabian (rechts) hören sich gegenseitig zu. Sie zeigen, was richtigen Dialog ausmacht.
Unsere Vorstellung von Gott wurzelt oft sehr tief. Wer hat Sie drei glauben gelehrt?
Daniel Fabian Ich muss vorausschicken: Ich habe erst im Laufe meines Lebens den Weg zur Religion gefunden. Meine Familie, meine Eltern, meine Großeltern waren keine praktizierenden Juden. In die Synagoge gingen sie eher selten und es wurde nicht Schabbat gehalten oder koscher gegessen. Ich wusste, dass wir alle jüdisch sind, aber Gott spielte quasi keine Rolle.
Mansur Doğan Ich bin in einer migrantischen Familie in Neukölln aufgewachsen. Hier war es üblich, die Kinder zu den klassischen Moscheeverbänden zu schicken für die Unterweisung in den Islam. Bei mir war es anders, weil meine Mutter skeptisch war und die Verantwortung nicht in deren Hand legen wollte. Ihr war wichtig, dass ich ein Vertrauensverhältnis aufbaue zu Gott. Den Koran zu lesen und die Grundsätze des Koran habe ich dann von einer Tante gelernt, was durchaus unüblich war für einen muslimischen Jungen.
Felix Körner Bei mir war es eher das Übliche: Ich war mit meinem anderthalb Jahre älteren Bruder in einem katholischen Kindergarten, bei ganz tollen Ursulinen. Wir gingen zusammen zur Erstkommunion und zur Firmung, hatten einen meist sehr guten Religionsunterricht, waren Messdiener in unserem Stadtkrankenhaus. Unsere Mutter war eine ernsthafte, aber auch kritische Katholikin, unser Vater war evangelisch und wurde im Alter immer religiöser. Das hat dazu geführt, dass wir über Glauben und religiöse Praxis viel diskutiert haben.
Ein enges oder strenges Gottesbild hat niemand von Ihnen vermittelt bekommen?
Doğan Nein, gar nicht, aber das war eher ungewöhnlich. Bei vielen Gastarbeiterfamilien ging es darum, in der deutschen Gesellschaft ein möglichst gutes Bild abzugeben. Deswegen wurde Religion oft als Erziehungsstruktur eingetrichtert – nicht so sehr als liebevolle Verbindung zu Gott.
Fabian Bei mir war es definitiv kein strenges, aber eigentlich fast gar kein Gottesbild.
Wie wurden Sie dann praktizierender Jude?
Fabian Prägend waren vor allem die Ferienlager mit anderen jungen jüdischen Menschen. Da wurde ich zum ersten Mal mit religiös gelebter Praxis konfrontiert und fand das toll. Da habe ich mich aufgehoben gefühlt und es kam zum ersten Mal so ein Gefühl von Stolz raus, jüdisch zu sein und jüdische Rituale zu praktizieren: Gemeinsames Gebet und lautes Singen – das empfand ich als befreiend.
Das klingt mehr nach Glaubenspraxis als nach Diskussionen über Gott.
Fabian Stimmt, eigentlich hat Gott gar keine Rolle gespielt. Da wurde einfach mit Freude gebetet.

Doğan Das erinnert mich an meine Zeit im Gymnasium in Berlin. Da habe ich ein paar Mal versucht, mit anderen Jugendlichen über meinen Glauben zu sprechen, auch kritisch, weil ich wusste, dass es besonders seit dem Terror des 11. September brennende Fragen gibt. Aber die Gespräche wurden sofort abgeblockt. Über Gott zu sprechen, war einfach uncool, Gott war out.
Aber irgendetwas haben Sie sich doch vorgestellt, wenn Sie Gott oder Allah gesagt oder gebetet haben.
Körner Dazu fällt mir etwas ein, was ich noch nie erzählt habe: Im Kindergarten, mit vier oder fünf Jahren, habe ich einmal Gott gemalt – ohne, dass die Schwestern das vorgeschlagen hatten. Auf riesigem Papier, ganz in Gelb. Eine große Figur, die auf einer Stange sitzt wie ein Vogel. Vielleicht sollte es der Heilige Geist sein, ich weiß es nicht. Ich habe das dann zu Hause erzählt und unsere Mutter, die ja einen sehr reflektierten Glauben hatte, hat gesagt: „Ach, komm! Gott, kann man sich doch nicht vorstellen.“
Doğan Ich habe auch eine Anekdote: Im Islam soll man sich kein Bildnis von Gott machen. Trotzdem ist es unvermeidlich, auch aus kindlicher Naivität. Wir waren mal in einem Kiosk mit meiner Mama, und da war eine große Frau im Hijab, in Vollverschleierung und komplett in Schwarz. Weil ich das so gar nicht kannte, kam sie mir sehr erhaben vor. Ich habe meine Mama später gefragt: War das Allah? Und sie hat geantwortet – nicht böse oder schimpfend: „Nein, das war nur ein Geschöpf von Gott. Gott ist etwas, was du dir überhaupt nicht vorstellen kannst.“
Körner In meinem späteren Leben gab es eine Zeit, da habe ich gedacht: Mein Beten darf nur Zen sein, also die Technik des Überhaupt-nicht-mehr-Denkens und Überhaupt-nichts-mehr-Vorstellens. Das habe ich zehn Jahre lang praktiziert. Da war ich schon Jesuit. Erst mit 40 habe ich unsere Ordenstradition der Imagination wiederentdeckt: Dass es in dir Bilder geben darf, die dir geschenkt werden können. Die sind nicht die letzte Antwort auf die Frage: Wie ist Gott? Aber sie helfen dir, seine Zuwendung zu spüren und seinen Ruf zu hören.
Sie sind alle Theologen. Welches Gottesbild haben Sie jetzt?
Fabian Im Judentum haben wir ein Gebet, das heißt „Avinu malkenu“, wobei avinu „unser Vater“ bedeutet und malkenu „unser König“. Das avinu zeigt, dass die Beziehung zu Gott eine persönliche ist: Gott ist zugänglich für den Einzelnen, man braucht keinen Vermittler. Er ist der Vater, an den man sich wendet und der einem von klein auf sehr, sehr nah ist.
Körner Was mich an das Vaterunser erinnert. Wobei meine Mutter immer gesagt hat: „Auch wenn wir das Vaterunser beten – stellt euch das nicht zu konkret vor, das wird nur falsch.“
Fabian Eben, denn auf der anderen Seite ist da die Erhabenheit eines Königs. Das im Kopf miteinander zu vereinbaren, ist sehr schwierig, weil man sich entweder jemandem sehr nah fühlt oder vor ihm einen sehr großen Respekt hat. Aber das ist unser Gottesbild: Auf der einen Seite ist da so eine unglaubliche Nähe – auf der anderen Seite die totale Erhabenheit und das Gefühl, dass Gott viel größer ist, als man sich das jemals vorstellen kann.
Doğan Ich sehe in der Nähe zu Gott eine Parallele zum Islam: dass es keinen Vermittler gibt. Dass ich in jeder Lebenslage immer und überall zu Gott sprechen kann. Wir im Islam sagen: Gott ist mir näher als meine Halsschlagader. Aber gleichzeitig ist ihm auch nichts gleich.
Körner Ich möchte kurz auf die Halsschlagader eingehen. Wir Christen verstehen unter Nähe oft eine zarte Nähe: Gott wendet sich mir zu. Er ist der Vater, der mit offenen Armen dasteht und darauf wartet, dass ich zurückkehre. Die Rede von der Halsschlagader ist ja nicht so zart. Die steht im Koran in dem Zusammenhang, dass Gott immer weiß, was du tust. Ist das nicht eher eine kontrollierende Nähe?
Doğan Ja, absolut, und ich hadere manchmal damit. Ich glaube, das wird nie ganz aufhören, weil es einem unvermeidlich mitgegeben wird – egal, wie liberal die religiöse Erziehung auch sein mag: Es gibt jemanden, der alles sieht. Sei also wachsam! Du bist zwar ein freier Mensch mit einem freien Willen, aber alles Handeln hat seine Konsequenz. Ich versuche dennoch daran festzuhalten, dass Gott zwar diese kontrollierende Natur hat, aber auch die vergebende, die heilt. Das wurde in der Generation meiner Eltern oft vergessen. Sie hatten ein dogmatisches Gottesbild eines Gottes, der Gefallen daran hat zu strafen. Ich finde, unsere Hauptaufgabe in den muslimischen Gemeinden ist, das Bild des liebenden Gottes weiterzugeben. Da können wir uns ein Beispiel an den Christen nehmen.

Aber das kennen wir Christen doch auch: Ein Auge ist, das alles sieht, auch wenn’s in dunkler Nacht geschieht. Oder, Herr Körner?
Körner Aus meinen eigenen Erfahrungen zu Hause, im Religions-, Kommunion- oder Firmunterricht überhaupt nicht, nein. Aber andere haben das vielleicht anders erlebt.
Herr Fabian, das orthodoxe Judentum kennt 613 Ge- und Verbote, die eingehalten werden müssen. Ist Gott da nicht auch der strenge Überwacher?
Fabian Das wird manchmal so wahrgenommen, dass bei uns die Religion in alle Lebensbereiche eingreift. Aber die Gebote sind ja nicht dafür da, damit Gott zufrieden ist oder stolz. Das würde gar nicht zu seiner Allmächtigkeit passen, wenn wir ihn durch unser Handeln verärgern oder froh machen könnten. Ich sehe die Ge- und Verbote eher als 613 Möglichkeiten, uns zu entwickeln, über uns hinauszuwachsen. Dass Gott böse auf mich ist, weil ich etwas nicht einhalte, kann ich mir gar nicht vorstellen.
Herr Körner, welche Vorstellung haben Sie von Gott?
Körner Für den christlichen Glauben beginnt alles mit Ostern. Ohne Ostern wäre die christliche Bewegung undenkbar. Und natürlich ohne Jesus. Nach Bundeswehr und Zivildienst habe ich drei Monate in Nazaret verbracht, mit einer Gruppe von 25 jungen Menschen. Da wurde mir Jesus sehr nahe, lebendig, präsent. Wir sagen zu Jesus Gott, weil uns in ihm die Gegenwart Gottes geschenkt ist. Im Heiligen Geist können das alle Generationen neu erfahren. Das ist das Besondere an unserem Gottesbild.
Das ist die Dreifaltigkeit. Aber ist das derselbe Gott, den Judentum und Islam bekennen?
Fabian Ich habe mich das tatsächlich immer mal wieder gefragt, und ich bin zu dem Schluss gekommen: Ja, wir glauben alle an denselben Gott. Wir haben nur ein unterschiedliches Verständnis davon, was Gott von uns erwartet.
Körner Wir meinen alle den gleichen, weil wir alle denselben Gottesbegriff in dem Sinne haben, dass wir sagen: Gott ist der Ursprung, der Herr und das Ziel aller Weltgeschichte.
Doğan Im Islam gibt es seit Jahrhunderten Debatten darüber, ob Christen und Juden als Muslime, was Gläubige bedeutet, oder als Kafir, also als Ungläubige, gelten. Ich, als Theologe, würde sagen: Wir glauben tatsächlich an denselben Gott, weil wir uns demselben göttlichen Geheimnis nähern. Aber mit unterschiedlichen Erzählungen und unterschiedlichen Ritualen. Vielleicht so ein bisschen wie ein Licht, das durch verschiedene Fenster scheint – und jedes Fenster bricht das Licht anders.
Wenn Sie sich einig sind, dass es nur einen Gott gibt, an den wir alle glauben: Können wir dann auch zusammen beten?
Fabian Das ist ein bisschen schwierig. Einerseits haben wir zum Beispiel die Psalmen, die Juden wie Christen beten. Aber andererseits weiß ich gar nicht, ob dieses gemeinsame Beten nötig ist. Es ist ja gerade schön, dass wir unterschiedliche Traditionen haben. In dem, wie wir Gott sehen, sind wir halt unterschiedlich. Das kann auch ruhig getrennt bleiben.
Körner Katholischerseits gibt es die Assisi-Formel. Sie lautet: „Wir kommen nicht, um zusammen zu beten, sondern wir kommen zusammen, um zu beten.“ Danach beten alle nacheinander in ihrer eigenen Form. Papst Franziskus hat davon eine Ausnahme gemacht. Als er in Sarajevo war, hat er gesagt: Ich schlage euch hier ein Gebet vor, das wir – Juden, Muslime und verschiedene christliche Konfessionen – zusammen beten können. Das war so gut überlegt, dass da nichts drinstand, was die anderen nicht hätten sagen können. Um zu bezeugen, dass die Religionen uns nicht trennen, sondern dass wir auf dem Weg sind, Gottes Willen zu tun in gemeinsamer Weltgestaltung, geht das in Krisenzeiten.
Doğan Ich hatte das Glück, über die Uni zweimal in Jerusalem zu sein. Wir haben dort mit den Benediktinern zusammengelebt, und da habe ich das gemeinsame Gebet und Gottes Gegenwart erfahren dürfen. Dieses stille Gedenken, zum Beispiel in der Auferstehungskirche, an der Klagemauer, in der al-Aqsa-Moschee – an heiligen Orten, an denen Juden, Christen und Muslime zusammen waren.
Fabian Auch ich glaube, dass gegen ein gemeinsames Gebet zu einem konkreten Anlass als Zeichen der Verständigung und Einheit nichts einzuwenden ist. Aber mehr als das sollte es nicht sein. Wir Juden beten zum Beispiel seit Jahrtausenden auf Hebräisch und das wollen wir beibehalten. Ich erkenne darin keine Schwäche, eher eine Stärke.
Körner Ich habe mal zwei Frauen getroffen, die fragten, warum die Religionen sich nicht alle zusammenschließen können. Da wurde mir deutlich: Die beiden wollen eigentlich ihre Religion selbst machen; sie picken sich heraus, was ihnen nett vorkommt, ohne das Schwierige verstehen zu wollen.
Fabian Es ist eben falsch, wenn man religiöse Vielfalt als Bedrohung wahrnimmt und sagt: Wenn sich nicht alle zu hundert Prozent einig sind, dann muss es ja Streit geben …
Doğan … und dann wächst die Gesellschaft nicht zusammen und dann fehlt die Solidarität …
Fabian … das muss ja nicht so sein!
Muss nicht, aber kann. Ist das auch Ihr Auftrag hier am Institut: für mehr Verständigung zwischen den Menschen verschiedener Religionen zu sorgen?
Fabian Das Gespräch heute hat mir wieder vor Augen geführt: Mit Menschen anderer Religionen zu sprechen, ist eine totale Lernerfahrung. Ich höre andere Positionen, die sich dann manchmal als gar nicht so anders herausstellen. Ich kann sie mit meiner Position vergleichen, mich abgrenzen, aber auch herausfordern lassen und ein tieferes Verständnis von meiner eigenen Tradition bekommen.

Doğan Dialog der Religionen ist keine Taktik, sondern Spiritualität. Eben weil wir uns demselben göttlichen Geheimnis nähern. Manchmal ist es auch ein Stresstest. Oder die Erinnerung, mich zurückzunehmen und der anderen Seite zuzuhören. Das klingt jetzt ein bisschen romantisierend, aber ich finde, es ist auch ein Zeichen für die Liebe Gottes zu allen Menschen. Am Ende geht es nicht darum, welche Wahrheit näher bei Gott liegt, sondern darum, wie sehr unser alltäglicher Austausch von Respekt und Anerkennung geprägt ist.
Körner Und wir machen das hier an der Uni ja nicht nur für uns. Wir bilden islamische und katholische Multiplikatoren und Religionslehrerinnen aus, haben aber auch evangelische Hörerinnen und Hörer dabei. Dass sie erleben, wie wir zusammen diskutieren, forschen, lernen können, ist eine ungeheure Bereicherung. Jetzt sage ich aber noch die Formel der katholischen Kirche dazu, die ich treffend finde: „Die Begegnung mit Menschen anderer Religionen kann für beide Seiten Reinigung und Bereicherung werden.“ Es macht mich demütig zu merken: Der oder die andere lebt in einer Weise vorbildlich den Glauben, wie ich das vielleicht gar nicht schaffe. Davon kann ich mir eine Scheibe abschneiden.
Diskutieren Sie nicht darüber, welche Religion die wahre ist?
Körner Doch, ich will das immer diskutieren. Und ich meine auch, dass es zwar gute Gründe für die anderen gibt. Aber dass die Religion, die am meisten zur schenkenden Liebe aus Freude befreit, das Christentum ist. Das sage ich schon.
Doğan Ich finde es auch ganz zentral, dass jeder kraftvoll für seine Überzeugungen argumentieren kann. Das gilt auch für die Gebetspraxis. Es ist für mich selbstverständlich, dass ich in unserem Büro meinen Gebetsteppich ausbreite und vor dem Rabbi oder dem Priester bete.
Körner Und das am Institut für katholische Theologie!
Fabian Es ist doch so: Wenn ich Argumente hören kann, warum jemand anderes seine Religion als die wahre empfindet, dann ermöglicht das doch gerade, mich selbst zu fragen: Was denke ich darüber? Vielleicht stimme ich in einigen Punkten überein, dann habe ich etwas vom anderen gelernt. Oder ich kann sagen: Ich finde trotzdem, dass meine Glaubenstradition da und dort richtiger ist. Aber in jedem Fall ist es gewinnbringend.
Gewinnbringend auch für unsere Gesellschaft? Wo sehen Sie die gemeinsame Aufgabe der Religionen?
Fabian Wir haben jetzt ein paar tausend Jahre hinter uns, in denen wir gezeigt haben, dass wir in der Lage sind, die Religion als Vorwand zu verwenden, um uns gegenseitig zu schaden. Und wir haben alle gesehen, dass man durch Verständigung darauf hätte verzichten können. Ich glaube aber nicht, dass die Antwort heute wäre: Wir brauchen einfach keine Religion mehr und dann wird überall Weltfrieden sein. Vielmehr müssen wir es schaffen, mithilfe der Religion näher an das Verständnis und den Frieden heranzukommen.
Körner Und warum gerade Religionen, die verantwortlich sein sollen für Konflikte und Kriege, einen guten Beitrag zum Frieden leisten können? Weil Religion, richtig verstanden, volle Anerkennung des anderen bedeutet. Wenn wir glauben, dass wir anerkannt sind von Gott, und ihn anerkennen, folgt daraus, dass der Mitmensch ebenso anerkannt ist. Von Gott und von mir. Wenn Menschen Religion in diesem Sinne leben, können sie ein glückendes Miteinander in Verschiedenheit gestalten. Das traditionelle Wort dafür ist: Friede.
Doğan Auch im Bezug auf das bei uns schwierige traditionelle Verhältnis von Mann und Frau, unter dem noch heute Frauen leiden. Die theologische Überzeugung, keine Religion steht über der anderen, keine Ethnie oder kein Geschlecht steht über dem anderen, kann sehr inspirierend für den Alltag sein.
Zu den Personen
Alle drei Gesprächspartner arbeiten am Nikolaus-Cusanus-Lehrstuhl für Theologie der Religionen des Zentralinstituts für Katholische Theologie der Humboldt-Universität zu Berlin. Der Jesuit Felix Körner (62) leitet den Lehrstuhl, Mansur Doğan (33) ist islamischer Theologe und Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Daniel Fabian (51) ist dort ebenfalls Wissenschaftlicher Mitarbeiter und gleichzeitig orthodoxer Landesrabbiner und Polizeirabbiner von Sachsen-Anhalt.